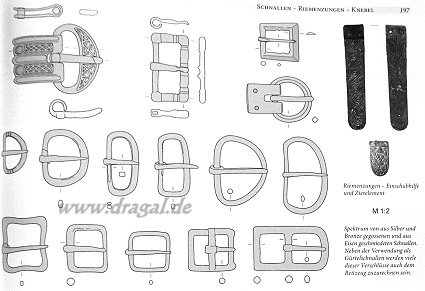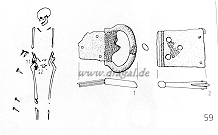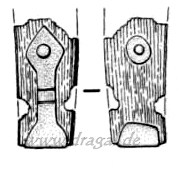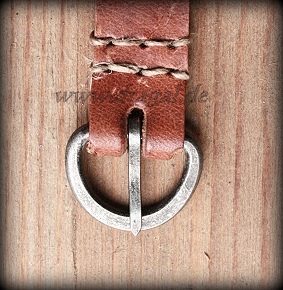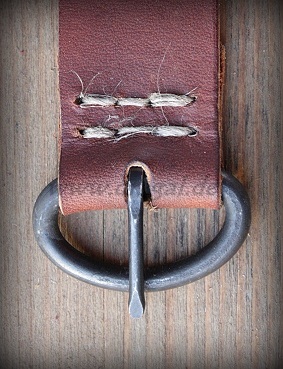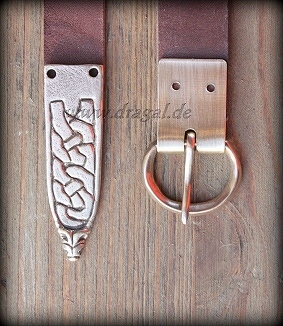___Info: Heeresverfassung und fränk. Panzerreiter
2. Gürtelrekonstruktionen Karolingerzeit
Zeitalter der sächs. Ottonen X. Jh
4. Gürtelrekonstruktionen Reichsgebiet, West-Slawen, Haithabu
WKZ - „Wikingerzeit“ IX.-XI. Jh
___Info: Innovationen im Schiffsbau
6. Gürtelrekonstruktionen Norwegen, Dänemark, Danelag
7. Gürtelrekonstruktionen Birka
8. Gürtelrekon. Gotland, Ost-Slawen, Rus, Reiternomaden
25. Dez 800 Krönung des Frankenkönigs Karl in der Peterskirche zu ROM durch Papst Leo III. (795-816). Das kam keineswegs so überraschend, wie es Einhard als Chronist behauptete, denn es war Kalkül. In Byzanz herrschte seit 797 Irene, Mutter von Konstantin VI., der nicht mündig war. Hier saß das „Haupt der Welt“, der Kaiser, aber im Westen erkannte man die Herrschaft einer Frau nicht an, demnach war der Kaiserthron vakant!
Ab nun dominierten herrschaftl. karolingische Formen den Kontinent, hatten Ausstrahlungskraft weit in die Peripherie, nachweisbar in Herren-Gräbern der Slawen und Nordleute. Jene nahmen auch Elemente nomadischer Völker auf und es wirkte in modischen Dingen das nach wie vor mächtige Byzanz, was zur Zeit sächs.-otton. Herrscher spätestens mit Ankunft Theophanus Ende des X. Jhs Leitcharakter im Reich bekam. Kennzeichen der WKZ war die Umformung älterer Tierstile hin zum „Greiftierstil“, während auf dem Kontinent nach der „anglo-karoling. Tier“- die „Pflanzenornamentik“ mit dem Akanthusmotiv Symbol der neuen Herrschaft wurde.
Historischer Kontext VIII.-IX. Jh:
Rückblick: In der späten MWZ waren Großgrundeigner und Hausmeier - eigentlich unfreie ministris - die Machthaber, keineswegs das Königshaus. Personalwechsel ermunterten in Tributpflicht stehende Völker zum Aufstand, niedergeworfen vom fränk. Heer mit seinen Panzerreitern. Zu Zeiten Karl Martells (Hausmeier 714-41) bekamen die wirtschaftlich erstarkenden Klöster auf dem Land Bedeutung und in den Städten wirkte die Kirche, deren Macht durch Ämter, Titel und Landschenkungen ständig wuchs. 751 okkupierte Karls Sohn, der ehemalige Hausmeier Pippin (der Jüngere -768) den Königsthron, durch den Bischof von Reims gesalbt und erstmalig vom röm Papst bestätigt. Das war heikel und eine Abkehr bisher üblicher Praktiken, Salbung als Ersatz für die legitime Königsnachfolge, die Geblütsheiligkeit der Merowinger! Bonifatius leitete einst die Bindung der Fränk. Kirche an Rom ein. Pippin war nun von „Gottes Gnaden“ (gratia dei rex) zum König berufen, als Preis dafür wurde er Schutzherr über Gebiete Italiens, die man für den Papst den Langobarden entriss – nicht weniger heikel, denn sein Vater Karl Martell hatte einst im guten Einvernehmen mit jenen die Araberabwehr organisiert und der fränk. Vasall Thassilo, Herzog der Baiuwaren, war mit einer Langobardin verheiratet!
Mit der Königsherrschaft Pippins wurde die fränk. Aussenpolitik zunehmend aggressiver, ein probates Mittel um die Mächtigen im Reich an sich zu binden. Auch sein Sohn Karl I. (d Gr 768-814) verstand es mit Machtübernahme die inneren Kräfte, welche ihm hätten gefährlich werden können, durch Feldzüge an sich zu binden; es gab bis 814 nur zwei Jahre, in denen keine unternommen wurden! 774 zerstörte er das Reich der Langobarden und übernahm deren Krone, drängte die Überlebenden nach Süditalien. Karl schlug rebellierende Baiuwaren und deren Nachbarn, die Awaren, war aber wenig erfolgreich gegen die Mauren und hatte Probleme mit sächs. Stämmen, die, seit langem zur Tributpflicht gezwungen, sich nicht fügen wollten. Zur Niederschlagung der Jahrzehnte währenden Aufstände setzte Karl die Missionierung „mit Feuer und Schwert“ ein. Er betraute Grafen (comites) mit Aufgaben in Verwaltung und Rechtsprechung sowie Aufbietung des Heerbanns. Markgrafen (marchiones) erhielten Privilegien und bes. Entscheidungsbefugnisse in Grenzschutzfragen.
Karl I. übernahm als erster fränk König 800 den westlichen Kaisertitel. Unter Karls Enkeln kam es zu Bruderkämpfen, was Angriffe von aussen begünstigte. Das fränk. Erbrecht verursachte Reichsteilungen mit allen daraus resultierenden Konflikten, nur nominell blieb die Einheit gewahrt. Bereits in den inneren Auseinandersetzungen unter seinem Sohn Ks Ludwig I. (814-840) bedrohten Nordmannen die Kanalküste und seit den 820ern „razzias“ der Sarazenen Südfrkrch und Italien. Bei jedem Thronwechsel nahmen die Angriffe zu [siehe “Wikingerzeit“]. Karolingische Strategie basierte auf Offensive und nötigte uneinige Herrscher zu Defensivmassnahmen; Küstenabschnitte und strateg. wichtige Räume, wie um Paris, wurden nach wiederholten Angriffen stark befestigt. Burgherren und regionale Machthaber gewannen deutlich an Einfluß, wollten sich einer Zentralmacht irgendwann nicht mehr beugen. 887 setzte man den letzten gemeinsamen Kaiser Karl III. (d Dicke, reg seit 881) wegen Versagens bei der Nordmannen-Abwehr ab. Als Ostfranke und Sohn Ludwigs (d Deutschen 843-76) vermochte er die Verteidigung Westfrankens nicht zu organisieren. Es wurde kein neues Oberhaupt mehr erkoren, sondern das große Reichsgebilde zerfiel endgültig in Teilreiche von eigenen Königen regiert.
Karolingerzeit VIII.-IX. Jh
Abb. eines comes (Grafen) und Kirchenstifters in Mals/Vinschgau Anf IX. Jh
eis = Eisen, me = Messing, bz = Bronze, vs = versilbert, si = Silber, vg = vergoldet
[manche der verwendeten Legierungen sind nicht eindeutig rot- oder gelbtonig, sondern bewegen sich, wie früher durch das Einschmelzen von Altmaterial, farblich dazwischen]
FrGr = Frauengrab, FO = Fundort, AO = Aufbewahrungsort, ae = ähnlich
Ost- und West-Franken gingen mit Arnulf v Kärnten (reg 887-99) und Odo v Paris (reg 887-98), die sich beide im Kampf gegen Nordmannen ausgezeichnet hatten, von nun ab eigene Wege. Norditalien war an die Kaiserkrone gebunden, die aber nicht mehr beansprucht wurde, Italien sollte Zankapfel vieler Parteien werden.
Ermoldus Nigellus zur Taufe von Harald Klak 826 am Hof Ludwig I.: „Herold in weissem Gewande, der geistig auch wiedergeborene, geht in das schimmernde Haus, welches sein Pate bewohnt. Ihm übergibt der erhabene Kaiser die reichsten Geschenke, wie sie der Franken Gebiet nur zu erzeugen vermag“
Notger über Ludwig I. (d Frommen, Sohn Karls I.): „An diesem Tage teilte er auch allen, die im Palast aufwarteten und am Hofe des Königs dienten, je nachdem, was der einzelne war, Geschenke aus, so dass er den Vornehmeren allen Wehrgehänge oder Gürtel und wertvolle Kleidungsstücke ...austeilen ließ, den Geringeren aber friesische Mäntel von jeder Farbe gegeben wurden, während Pferdewächter, Bäcker und Köche mit Kleider aus Leinen und Wolle und halblangen Schwertern, wie sie es brauchten, bedacht wurden.“ [THH 84, S. 153f]
1. Quellen für die Karolingerzeit:
Auf dem Kontinent stellte das Auslaufen der Grabbeigabensitte durch die Christianisierung eine Zäsur dar. Lediglich Kleinschmuck und Fibeln, als Bestandteil der Kleidung oder als Leichentuchverschluß, lassen sich in Gräbern teilweise noch bis ins HMA nachweisen. Gemessen an der hohen Zahl von Fundstücken aus Reihengräberfeldern bis zur späten MWZ ist der archäologische Fundanteil an geborgenen Gürtelteilen aus Bunt- oder Edelmetall zu karolingischen Zeiten in West- und Mitteleuropa sehr gering. Doch war diese Zeit keineswegs „buntmetallarm“ [siehe Messing und Bronze im FMA]. Karolingische Formen haben vornehmlich in Gräbern der Skandinavier, Balten sowie West- und Südslawen überdauert oder in Hort-/Depotfunden siehe im dän. Duesminde auf Lolland aus dem IX. Jh mit vielen kostbaren Silbergürtelteilen. Solch prestigeträchtigen Luxusgüter wurden allerdings selten in ihrem ursprünglichen Funktionszusammenhang belassen, sondern nach eigenem Geschmacksempfinden umgeformt. Bekannt sind Zaumzeugverteiler, welche in Skandinavien zu Fibeln oder Gürtelzungen umgearbeitet wurden. Und doch sind Rückschlüsse auf das fränk. Reichsgebiet erlaubt, wo sich Metalle eher in anderem Kontext dokumentieren lassen, z.B. bei Siedlungsgrabungen. Es gab dort kein Bedürfnis Alltags- oder Prunkgegenstände durch Bestattungen unter die Erde zu bringen. Christliche Begräbnisse hatten für Angehörige den Vorteil keine Beigaben aufgrund gesellschaftlicher Konvention und Prestige zu verlieren, wie im Norden und Osten Europas üblich [siehe Grabinventare]. Ausserdem war es kostengünstig Messen durch Priester lesen zu lassen. Hinterlassenschaften wurden vererbt oder „recycelt“ in den wirtschaftlichen Kreislauf eingebunden. Fundstellen für Buntmetall- und Eisenproduktionen gibt es eine ganze Reihe, bsplw die Eisendeponierung im niederösterr. Thunau um 900. Buntmetalle waren seit römischen Zeiten begehrte Rohstoffe und wurden eingeschmolzen, das zeigen metallurgische Untersuchungen der Mischformen von Kupfer, Zinn, Zink und Blei. Strenge Legierungen nach unseren heutigen Standards gab es nicht.
Nach der Währungsreform Karls I. (768-814) von Gold- auf Silberwährung war das Edelmetall in Form von Münzen und Schmuckstücken im Norden von Begehr, es kursierte. So finden sich relativ wenig erhaltene karolingische Silbermünzen im Norden, weil es akzeptiertes Zahlungsmittel in Richtung auf den Kontinent im Erwerb von Gütern war. Ausfuhrverbote zeigen, dass Skandinavier und Slawen nicht nur versuchten Schwerter, Waffen und Pferde zu erbeuten, sondern auch zu kaufen. Umgekehrt bekam Ludwig II. (d Deutsche, reg 843-76) als Gastgeschenk skandinavische Schwerter überreicht, die sich angeblich nicht durch hohe Qualität auszeichneten. Er prüfte wohl durch Biegen die Klingen, wovon eine zerbrach, eine andere in ihre ursprüngliche Lage zurück schnellte, also durchaus gute Qualität aufwies [MuK, S. 7]. Die hohe Zahl erhaltener arab. Silber-Dirhems erstaunt nicht, alleine in Birka 60.000 Münzen. Da jene oft im Boden mit Münzwaagen vergesellschaftet waren, wurden sie nur im Osthandel als offizielles Gewichtsgeld akzeptiert. Mit dem Dirham konnte man in Skandinavien per Gewicht zahlen, auf dem Kontinent nur in slawischen Regionen. Metalldeponierungen deuten hinzu auf Einschmelzprozesse hin. Bis zur Mitte des X. Jhs wird man bzgl der arab. Währung dem Osthandel einen hohen Stellenwert in der nordischen Kultur einräumen. Nachdem Araber den Silbergehalt des Dirhams stark herabsetzten, wurde dieser uninteressant und der Handel verlagerte sich u.a. aufgrund neuer politischer Verhältnisse und Ressourcenzugang (Silber aus dem Harz) an die slawisch dominierte kontinentale Ostseeküste.
Erwähnenswert zum Komplex Grab, als „versiegende Quelle“, ist das fränk. Eigenkirchensystem, das eine Übernahme später in England und Skandinavien fand. Auf dem Kontinent behielt die traditionelle römisch-kathol. Kirche ihre Stützpunkte in den Städten. Die neue fränk. Staats-Kirche missionierte die heidnisch-germanische Landbevölkerung (pagan = ländlich, wurde synonym mit „heidnisch“) und ließ dazu „ausländische Eiferer“ von den westlichen Inseln wirken, die Klosterzellen gründeten. Iro-Schotten prägten die von den Franken abhängige Gebiete südlich des Mains bis zum Bodensee und zur Salzach. Die Angelsachsen genossen weiter nördlich rechtsrheinisch bei Friesen und Sachsen sprachliche Vorteile. Fränkische Landbesitzer betrachteten durch ihre rechtliche und finanzielle Unterstützung errichtete Kirchen und Klöster auf ihrem Grund als Eigentum, das verkauft oder vererbt werden konnte. Die erwirtschafteten Erträge kamen ihnen zugute. Das stand im Widerspruch zur römisch-kathol Lehre von der Einheit des Kirchenvermögens. Eigenkirchen besassen wohl kleine Westemporen, über schmale Stiegen erreichbar. Seit dem VII. Jh wurde es im fränk. Raum Sitte diese Kirchen als adelige Grablegen zu nutzen, ähnlich bei den Alamannen. Baiuwaren folgten dem Beispiel im Laufe des VIIII. Jhs.[1]
Nach Niederschlagung der Sachsenaufstände mit Hilfe der Missionierung als Herrschaftsinstrument wurde eine Reliquientranslation aus England und vor allem aus Nordfrankreich in den Raum von Werden an der Ruhr bis nach Freckenhorst und Hamburg sowie nach Quedlinburg und Erfurt vorgenommen. Aachen, Hersfeld, Fulda und Würzburg mussten Reliquien abgeben. In Kirchen- und Klosterschätzen sollten sich deren Behältnisse in Form von Kästchen, aber auch Stoffe, Möbel oder Leuchter erhalten. Mancher dieser profanen Gegenstände wurde damit in sakrale Sphären überführt, erlauben in begrenztem Maß Einblicke in die Alltagskultur gehobener Schichten. So vermachte man kostbare Hochzeitsgewänder nicht selten der Kirche oder Damen gehobener Schichten brachten sie mit in die Klöster, wo sie zu liturgischen Kleidungsstücken umgearbeitet wurden.
Priesterliche Gewandung läßt sich aufgrund erhaltener Stücke oder anhand von archäologischen Funden, Abbildungen und Textquellen rekonstruieren. Kostbare Stoffe und Goldborten dienten dazu der Würde des geistlichen Amtes Ausdruck zu verleihen, in antiker Tradition. Papst Stephan II. (725-757) gewährte Abt Fulrad von St. Denis den ornatus apostolici zu tragen samt Strümpfen, Sandalen und der Reitdecke. Hrabanus Maurus beschrieb 819 in Bezug auf eine alttestam. Textstelle zeitgenössische liturgische Gewänder, die nur bedingt Ableitungen zur weltlichen Bekleidung der Oberschicht erlauben. Er nannte als Gürtel ein cingulum bzw balteus, mit dem das Untergewand aus Leinen, die „Albe“ (tunica albea), gerafft wurde. Darüber trug der Priester als Oberbekleidung die „Dalmatika“ und bei Messfeiern hinzu die „Kasel“. Die „Albengürtel“ wurden nach „gallischer Variante“ mit einer grösseren Zunge, auf den Oberschenkel herab hängend, getragen. Auf Abbildungen des IX. Jhs sind solche hervorgehoben und erhaltene Exemplare aus kostbarem Edelmetall mit aufwändigen Verzierungen oder segnenden Inschriften konnten Breiten bis über 4 cm aufweisen. Die Albe wurde meist so stark gerafft, dass sie die Schnalle verdeckte. Die zweite Variante galt als sogenannter „römischer Typus“, ein Bindegurt mit zwei lang herab hängenden Enden, die unter der Dalmatika auf Schienenbeinhöhe sichtbar waren und in Quasten oder/und quadratischen Beschlägen ausliefen. Sie wurden teilweise in „Buchform“ gestaltet, dem würden bekannte Funde aus dem Mährerreich zuzuordnen sein. Eine Darstellung des polnischen Kgs Kasimir II. (1163-77) aus Wislica zeigt noch im XII. Jh auf Kniehöhe getragene runde Abschlüsse seines Bindegurts in „röm Manier“.
Da sind sie gerade vorbei am Bauernlümmel, Helden der Kindheit, …reiten die Recken, stattlich an Zahl: Hettel und Frute aus Hegelingen, Herwig von Seeland, Siegfried von Morland, Hettels Schwesternsohn Horand von Danmark, Irold von Ortland, Morung von Friesland, der junge Ortwin und der alte Wate aus Stürmen von Danmark, Hugdietrich und Wolfdietrich, Walther vom Wasgenstein, Eckehart, Wittich und Heime auch, Dietleib der Däne, Berchter von Meran, zur Linken trabt Meister Hildebrand von Garden, Bannerträger ist Rüdiger von Bechlarn, es führt Dietrich von Bern. Man wird ihnen nacheifern, über Jahrhunderte die alten Mären erzählen, umdichten je nach Zuhörschaft und im HMA niederschreiben, auf der Suche nach der eigenen Identität.
Exkurs: Heeresverfassung und der fränk. Panzerreiter
Fortführung von Gesellschaftl. Strukturen im Wandel von der Spätantike zum FMA. Karl Martell (714-41) stützte sich auf ein schlagkräftiges Offensiv-Heeres (expeditio) mit starker Reiterei, um den Bestand des Reiches zu sichern, fällige Tribute einzutreiben oder säumige Klienten abzustrafen. Es wurde gestellt von den Mächtigen im Reich mit ihren Gefolgschaften, welche Distanz-Feldzüge zu führen imstande waren, zwangsweise unterstützt durch Kontingente unterworfener Völker gentes subactae. Benötigt wurden im Troß Diener, Handwerker und Verpfleger, zudem Versorgungsstützpunkte auf der Marschstrecke. In Notzeiten beriefen zur Verteidigung die Grafen regional das Defensiv-Aufgebot ein, den hereban (Heerbann). Grundeigner waren als Freie [„Bauer“ ist ein unpassender Begriff] zum Kriegsdienst verpflichtet, mehrheitlich wohl zu Fuß. Schrieb der Heerbann eine Mindestrüstung nach Grundbesitz vor, waren Gefolgschaften sicher weit besser ausgerüstet, da Mittel durch deren Herren für Bewaffnung und Ausrüstung zur Verfügung standen. Der Herrscher bemühte sich also besonders um Fürsten, Grafen, Bischöfe und jene, denen ein Gefolge Lehnsleute anhing, sich hinzu eine Schar als Haustruppe halten konnten. „Treue - Beute - Geschenk“ galten als Kittmasse in einem komplizierten Beziehungsgeflecht. Geben und Nehmen hatte zeremoniell verpflichtenden Charakter.
Karl I. (d Gr, 768-814) fügte 807/08 eine Anzahl Mansen (Güter) zu einer Wehrgemeinschaft zusammen und nötigte nur einen der Besitzer zum Kriegsdienst. Die anderen leisteten das servitium mit Stellung von Lebensmitteln, Karren, etc. Verantwortlich zur Durchführung waren die Grafen. Freie mit Waffenpflicht konnten einen Ersatzman stellen oder Kriegssteuer zahlen zugunsten der Reiterelite, kleine Hofstellen gerieten damit in Abhängigkeit der Großgrundeigner, welche Reiter zu stellen vermochten und verloren in Folge ihren Status - Freie wurden zu Halbfreien. Sie nährten damit ein Berufskriegertum, professionell und effektiv durch bessere Ausrüstung und ständige Waffenübung. Der Wert von 45 Kühen für einen Panzerreiter wird oft zitiert, worauf die Schlagkraft des Offensiv-Heeres basierte. Mit der Eingliederung der langobard. Verbände nach der Eroberung Norditaliens durch Karl I. (d Gr) Ende des VIII. Jhs erhielt die fränk. Reiterei einen Qualitätsschub. Weitere Grundvoraussetzung war die Züchtung geeigneter Pferderassen - es wurde ein Embargo verhängt, genauso wichtig sollte später die Einführung des Hufeisens um 900 werden, um den Huf zu schonen, aber auch mehr Zugfestigkeit, bzw Wendefähigkeit im Gefecht zu ermöglichen! Bei den weiträumigen Feldzügen der Karolinger war der gut gerüstete Panzerreiter gefragt, was die Masse zu Abgaben an Naturalien, Diensten und Münze zwang. Das heribannum degnerierte schließlich zu einer Abgabe und Steuer. Im Urbar zu Werden von 880 zahlten die Freien Folkward, Thiadward und Theganrad der Hofgenossenschaft Stiepel dafür je 8 Denare. Für Defensiv-Aufgaben im allg. Heerbann blieb die alte Regelung wirksam mit Einberufung der Miliz-Kontingente. Dazu konnten auch Hörige heran gezogen werden [hier ist der Begriff „Bauer“ angebrachter], das war bis ins HMA üblich, siehe Fuldaer Fehde 1265 oder Worringen 1288. Das nord. Hirðskrá, Gefolgschaftsrecht aus dem XIV. Jh, wies Hörigen den Waffendienst zu, Knechten nur zur Not. Friedrich I. Barbarossa hatte noch 1156 Bauern das Tragen von Waffen verboten, der Bay. Landfrieden von 1244 und 1256 erlaubte es Grundeignern, siehe Details: Gefolgschaft-Lehen-Panzerreiter
2. Gürtelrekonstruktionen der Karolingerzeit VIII.-IX. Jh [A-C]
Sie sind geeignet für karolingische, sächsische und slawische sowie bis in die 1. Hälfte des X. Jhs auch für Nordische Darstellungen aus Dänemark, Haithabu oder Birka. Schnallen dieser Zeit weisen in der Regel Durchzugbreiten zwischen 2 und 4 cm auf. Schmale Formen wurden auf dem Kontinent für Sporengarnituren verwendet, im skandinavischen Norden für Gürtel und Schulterschwertriemen. Im baiuwar.-slawischen Grenzraum nahm der karolingische Einfluß mit dem Ende der Agilofinger Herzöge im auslaufenden VIII. Jh zu, zeitgleich als Kriege gegen die Awaren geführt wurden. Deren Formen gelangten als Beute in den Westen..
-
Karolinger / Slawen
-
Karolingische Schnallen und Zungen mit stilisierten Akanthusblüten lassen sich im Kerngebiet des Reiches archäolog. nicht mehr nachweisen, finden sich hptsl. in den ehem. Grenz-Marken, in Osteuropa oder in Schweden und Dänemark. Diese großen Ausführungen sind eindeutig Gürteln zuzuordnen. -
Zungen mit abgefastem Rand sind bereits älter und seit dem VII. Jh in Gebrauch, häufiger Bestandteil von Wadengarnituren, seit dem VIII. Jh wurden Zungen kürzer, U-förmig oder spitz zulaufend.
[Ausführung in Sterling-Silber für A mgl]
-
IX-X_004e oder f_bz [Detailbild li oder re]
30 mm Riemen (natur/braun/rot)
und Zunge e [links] oder f [rechts] je 149,00 EUR
-
IX-X_004td_bz
30 mm Riemen (natur/braun/rot)
und mögliche Zunge_bz
montiert 149,00 EUR
-
Karolinger / Slawen / Nordmannen
Schnalle mit stilisierten Akanthusblüten nach Funden einer Schwertriemenschnalle aus dem Mährerreich 2. Hälfte IX. Jh oder aus Birka KaGr 750 erste Hälfte X. Jh und weitere Stücke aus dem dän. Duesminde-Hort.
[Ausführung in Sterling-Silber für A mgl]
-
IX-X_003c_bz
25-30 mm Riemen (natur/braun/rot)
und U-förmige Zunge_bz {Nieten ersetzen}
montiert 129,00 EUR
-
IX-X_003f_bz
25-30 mm Riemen (natur/braun/rot)
und mögliche Zunge im spätawar.Stil_bz
montiert 129,00 EUR
-
Karolinger / Slawen / Nordmannen
Schnalle mit Akanthusblüten als Zeichen des erneuerten Imperiums der karoling. Herrscher. Alle nun folgenden Schnallen waren ursprünglich Bestandteil von Sporenriemengarnituren aus reich ausgestatteten Gräbern, so z.B. in Mähren. In Skandinavien wurden sie bis in die 1. Hälfte des X. Jhs eher für Gürtel und Schwertschulterriemen genutzt, siehe Birka KaGr 750 und weitere Stücke aus dem dän. Duesminde-Hort.
-
IX-X_001c_bz
20-25 mm Riemen (natur/braun/rot)
und U-förmige Zunge m Nietblech_bz
montiert 129,00 EUR [Detailbild Tragweise]
-


IX-X_001f_bz
20-25 mm Riemen (natur/braun/rot)
und mögliche Zunge im spätawar.Stil_bz
montiert 129,00 EUR
[Veredelung in Silber oder Gold für „A“ mgl]
-
Karolinger / Sachsen
-Zunge Direktabguss vom Original, nähert sich im Stil Beschlag von Westernkotten bei Unna und Fund aus der Festung Christenberg nördl. Marburgs an, nimmt im Kerbschnitt Bezug auf den älteren „Insularen Stil“, der traditionell Bezüge zum sächs. Raum aufwies.
Dargestellt ist ein Greif mit Schlangenschwanz, sowohl im Heiden- als auch im Christentum beliebtes Motiv, wurde über Jahrhundert in Architektur-Elementen zitiert, bis hin zu Bodenfliesen im MFM, Würzburg um 1500. Das Doppelwesen galt als Hüter und Wächter mit übernatürlicher Kraft.
[Veredelung in Silber oder Gold mgl]
-
IX-X_001b vs
20-25 mm Riemen (natur/braun/rot),
und Kerbschnitt-Zunge_vs
montiert 149,00 EUR
[Ausführung in Sterling-Silber für A mgl]
-
IX-X_001b_bz
20-25 mm Riemen (natur/braun/rot)
und Kerbschnitt Zunge_bz
montiert 129,00 EUR
-
Karolinger / Sachsen / Slawen
Herrenhof Thunau Gr. 129 „um 900“ (Mus. Asparn), Rahmen etwas höher als bei der Nachbildung. Flache vergoldete Ausführung Ende VIII. Jh aus Müstair/CH. Sächsischer Fund Groß-Hesebeck, Gem. Bad Bevesen, bezeichnet als Schnalle mit "gebuckeltem Bügel“, 765 bis 835 datiert.
[Markante „Buckel“ sind auch noch später an einer Skulpturenschnalle im Kreuzgang von Arles um 1180 zu finden, hat nur erheblich größere Dimensionen!]
-
IX-X_005c_bz
20 mm Riemen (natur/braun/rot)
und U-förmige Zunge m Nietblech_bz
montiert 99,00 EUR
-
IX-X_005b_bz oder vs
20 mm Riemen (natur/braun/rot),
und Kerbschnitt-Zunge_bz
montiert 99,00 EUR bz / 120,00 vs
-
Karolinger / Slawen / Nordmannen
Eckige Schnallentypen bereits im VIII. Jh häufig, diverse Funde auch in Haithabu und Birka. Die gezackte Form nach Fund aus dem Alpen-Donau-Raum. „U“-förmige und rechteckige Riemenzungen in karolingischen Zeiten üblich, kleine Exemplare finden sich bei aufwändigen Sporengarnituren, grössere Prunkstücke wurden in Skandinavien auch zu Fibeln umgearbeitet.
[Veredelung in Silber oder Gold für „A“ mgl]
-
IX-X_006c_me
20-25 mm Riemen (natur/braun/rot)
und U-förmige Zunge_me
montiert 99,00 EUR
-
IX-X_007c_bz
20-25 mm Riemen (natur/braun/rot)
und U-förmige Zunge_bz {Nieten ersetzen}
montiert 129,00 EUR
-
Karolinger / Slawen
Schnalle rechts nach Fund aus dem Kloster Lorsch, Original Eisen, hier Bronze, mit Blech versehen. Eckiger Typ ganz rechts bereits seit der späten MWZ üblich. Kombination mit Riemenende als Derivat eines spätawar. Scharnierbeschlags, wie es in Zweitverwendung gemacht wurde, aus der Beute siegreich geführter Awarenkriege der Franken, wohl ähnlich zu sehen, wie die bekannten Kleeblattverteiler.
-
IX-X_030f_bz
20-25 mm Riemen (natur/braun/rot)
und mögliche Zunge im spätawar.Stil_bz
montiert 99,00 EUR
-
IX-X_007f_bz
20-25 mm Riemen (natur/braun/rot)
und mögliche Zunge im spätawar.Stil_bz
montiert 110,00 EUR
siehe Gürtel mit Eisenschnallen VIII.-XI. Jh
Zu den Kategorien A-E im Detail: Gesellschaftsstrukturen des FMAs
Slawen: Der ostfränk. Kg Ludwig (d Deutsche, reg 843-76, Enkel Karls d Gr), dessen Stammbasis in Bayern lag, führte zahlreiche Kriege gegen Slawen von der Ostsee bis nach Karantanien, um jene in Tributpflicht zu halten. Nachdem sich sein eigener Sohn Karlmann mit dem Mährerreich verbündet hatte, suchte er Bündnispartner, fand sie u.a. in den thür.-sächs. Liudolfingern, denen im X. Jh ein steiler Aufstieg im Reich vergönnt sein sollte. In Osteuropa gewannen die Familien der Premysliden in Böhmen, Piasten in Polen und Arpaden in Ungarn an Macht. Durch Übernahme des Christentums stärkten sie ihre Bindungen zum Westen und begannen sich in die Adelshäuser Europas einzuheiraten. Gestützt auf ein gut gerüstetes Gefolge weiteten sie ihre Territorien kontinuierlich aus und unterwarfen pagane Nachbarn, legitimiert durch den christl. Glauben. Der jüd. Reisende Ibrahim ibn Jakub um 965 über Gefolgschaften der Abodriten, darunter Wagrier in Starigard: „...reich an Pferden, so dass solche von dort exportiert werden...sind mit Waffen vollständig gerüstet, nämlich mit Panzern, Helmen und Schwertern“ [EM1000_III, S. 165]. Zum poln.-piastischen Herzog Mieszko (reg 960c-992) erwähnt er, dass dessen druzyna (Gefolge), worunter sich Mährer und Skandinavier befanden, nicht nur Kleider, Rosse und Waffen erhielt, sondern auch einen monatlichen Lohn, also wohl Münzgeld. Skandinavische Formen spiegelten sich bei Balten, Esten und Polen wieder. Zunächst ging es ostfränk.-otton. Herrschern vornehmlich um sichere Grenzen und ein stabiles Vorfeld nach röm Muster, doch nach und nach wurde die Missionierung weiter nach Osten getrieben. Im östl. Alpenraum traten Missionare aus Passau und Salzburg in Konkurrenz zu orthodoxen Missionaren und konnten jene vertreiben.
Zentralisierung oder Dezentralisierung der Herrschaft?
Auch der ostfränk. Kg Arnulf von Kärnten (reg 887-99) suchte Unterstützung im Kampf gegen das Mährerreich, dazu versicherte er sich magyarischer Hilfs-Kontingente. Nachdem aus ehem. Verbündeten Feinde wurden, waren die Wege in den Westen bekannt...und dieser Gegner sollte mit hoher Mobilität über Jahrzehnte viele Regionen in Mitleidenschaft ziehen. Die Abwehr war erschwert, da das Ostfrankenreich eigentlich nur ein loser Verbund von Stammesherzogtümern war. Weder Ludwig (d Kind, reg 900-911) noch Konrad I. (reg 911-18) vermochten die mächtigen Herzöge, welche eigenständige Politik betrieben, „auf Linie“ zu bringen und die Magyaren-Abwehr mißlang völlig. Notwendig war der Aufbau einer Offensivwaffe in Form schwer gepanzerter Kavallerie, bei Franken ja üblich, für Sachsen aber erst durch den thür.-sächs. Liudolfinger Heinrich I. (reg 919-36). Möglich war dies nur durch den Ausbau des Lehnswesens. Das erzeugte Abhängigkeiten und stärkte wirtschaftlich den regionalen Adel. Da Heinrich I., im Gegensatz zu seinen Vorgängern, die Magyarenabwehr zu organisieren wusste fand er die Unterstützung der Herzöge, förderte damit Prozesse der Reichseinigung zum „regnum teutonicum“, in den Quellen 920 erstmalig erwähnt. Es blieb aber der ständige Kampf um Legitimation einer Zentralmacht im Wahlkönigtum. Der Hochadel sollte weiterhin alles tun nur genehmen Vertretern seines Standes den Weg zum Thron zu bahnen.
Aus diesem Grund stärkte das neue thür.-sächs. Herrschergeschlecht, mit dynastischen Verbindungen zum Haus Wessex, seine eigene Hausmacht an der Elbe und im Harzvorland. Die Verlagerung des Machtmittelpunkts nach Osten forderte sichere Grenzen zu slaw. Stämmen östlich von Saale und Elbe. Zur Slawenmission wurde Magdeburg 968 unter Heinrichs Sohn Otto (reg 936-73) zum Erzbistum erhoben. Nun wandelte sich der Raum von einer karoling. Grenz-Mark zum neuen Kernland, bislang eher gekennzeichnet durch weite Waldgebiete, weniger durch gut ausgebaute Infrastruktur. Damit sollten beide Eroberungen Karls I. (d Gr) Sachsen und Italien richtungsweisend für die nächsten Jahrhunderte werden. Ziel der Reichspolitik war nun, neben sicheren Ostgrenzen, die Erlangung der Kaiserkrone in karoling. Tradition, was den „Sprung über die Alpen“ bedeutete, da der Kaiser als höchste Schutzmacht in Italien fungierte, was ihn aber unweigerlich in Konflikt mit dem östl. Kaisertum, den südital. langobard. Fürstentümern und nordital. Kommunen brachte.
Bischöfe und Äbte, auch Äbtissinnen, stammten zur Sicherung der Königsmacht häufig aus der Herrscherfamilie. Sie erhielten weltliche Machtbefugnisse und Rechte, wurden vielfach zu Fürsten erhoben und galten als reichsunmittelbar, nur dem König lehnsuntertänig. Als Herren mit großer wirtschaftlicher Macht nahmen sie an Kriegszügen teil und deren Gefolge stellte einen Gutteil der Panzerreiter.
Zeitalter der sächs. Herrscher X. Jh
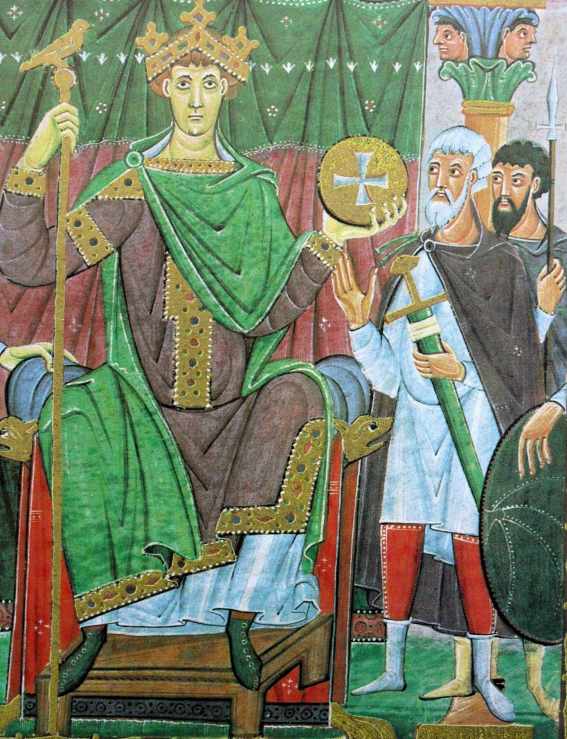
Otto III. (reg 983-1002), Szepter mit Victoria und Himmelsglobus als „christl. Kosmos“
eis = Eisen, me = Messing, bz = Bronze, vs = versilbert, si = Silber, vg = vergoldet
FO = Fundort, AO = Aufbewahrungsort
Der Chronist Thietmar vermerkt zum Feldzug Ottos III. (983-1002) gegen Böhmen 990, dass alle Streiter in Eisen gewesen seien, es handelte sich also um das „Offensiv-Heer“ der Mächtigen im Reich mit ihrem gepanzertem Gefolge.
Zur Eindämmung der Magyarengefahr hatte Heinrich I. (919-36) die Befestigung von Klöstern, Pfalzen und Ortschaften sowie die Neuanlage von Fluchtburgen verfügt. Jeder neunte Lehnsmanns der milites agrarii wurde zur Instandhaltung dorthin verlegt. Das war nicht mit Verleihung von Privilegien verbunden. Doch sollten hier Versammlungen, Märkte und Gerichtstage von Grafen und Schultheissen abgehalten werden, was eine Stadtbildung förderte, zumal Militär dort Schutz bot. Man wird vielleicht darin den Ursprung der späteren „Stadtministerialität“ zu suchen haben? Warum sollte sonst jemand freiwillig vom Land in die Stadt ziehen [~Schmunzel~]? Zunächst waren es Wall-/Palisadenanlagen, zwischen denen Handwerk und Landwirtschaft betrieben wurde, wie es wohl auch in Haithabu der Fall war, bislang wurde ja nur der dicht bebaute Hafenteil exakt erfasst, da regierte Handel und Handwerk. Der Ort war übrigens ab 934 Bestandteil von Heinrichs Reich und die Sachsen sorgten für die Umwallung, die heute noch sichtbar ist.
3. Quellen für die Zeit der otton.-sächs. Herrscher:
Aufgrund der Christianisierung bleibt die Quellenlage bzgl mangelnder Grabfunde auf „Reichsgebiet“ schwierig[2]. Sie lassen sich nur exterritorial erfassen. Eher sind wir auf Ergebnisse der Burg-, Motten- und Siedlungsgrabungen angewiesen. Häufig steht man rechtsrheinisch und nördl. der Donau erst am Beginn einer Verstädterung. In Süd- und Westdtld liefern die ehemals römischen Stadtgründungen in ihrer Kontinuität zeitlich breit gestreute Funde, wie in Italien und Frankreich. Grundsätzlich gilt für den Gürtel, dass die Anzahl exakt datierter archäologischer Schnallenfundstücke auf Reichsgebiet gering ist, gemessen z.B. an der hohen Zahl von Preßblech-, Scheiben- oder Emaillefibeln. Letztere konnten in Gräbern als Leichentuch-Verschlüsse dienen. Riemenzungen sind in diesem Zeitraum ausserordentlich seltene Funde, Sporen und Zaumzeugteile hingegen häufig und dienen deshalb, ähnlich wie Keramik, als Leitdatierung. Skulpturen und Abbildungen sind selten oder „grob gearbeitet“, dass Details meist untergehen. In der byzantinisch orientierten Mode des Adels konnte zum Ende des X. Jhs ein reich verzierter und besetzter breiter Stoffgürtel Bestandteil der Kleidung sein.
 Byzant.-italienischer
Einfluß auf karoling.-ottonische „Prachtmode“:
Kleidung
unterer Volksschichten war germanisch und die der Kleriker
spätantik geprägt, wobei sakrale Kult-Tracht ehrwürdiges
Alter, Privilegien und Unantastbarkeit ausdrückte. Auch
Herrscher folgten antiken Traditionen, um Legimation oder
Ansprüche zu verdeutlichen, so wusste man sich in besonderen
Repräsentationsmomenten standesgemäß „römisch“,
bzw „griechisch“ zu kleiden. Bereits Karl
I. (d
Gr.) war am Weihnachtstag 800 in Rom nicht in „fränk.
Tracht“, sondern mit langer Tunica und der „chlamys“,
dem röm-hellenistischen Mantel, erschienen. Während der
Krönungszeremonie warf Karl die „chlamys“
ab und schwang sich das
purpurfarbene Ornat des oström Kaisers über. Auch sein
Enkel Karl II.
(d Kahle
843-77) verfuhr so, zur Kaiserkrönung in Rom trug er 875/76
anläßlich der Kirchenversammlung ein Gewand mit
dalmatischem Talar. Bei Ankunft in Rom war Karl noch in „fränk.
Tracht“ eingeritten.[3]
Beide
provozierten
mit der „griechischen Gewandung“ bewußt,
formulierten ihren Machtanspruch in Anlehnung an das oström
Kaiserhaus, was sich brüskiert sehen musste, denn der
Basileus
in
Konstantinopel verstand sich als einziger legitimer Nachfolger der
Caesaren. Bereits merowingische Goldmünzen mit eigenem
Herrscherabbild galten als Affront und Angriff auf die Stellung
des oströmischen Kaisers. Franken und Ottonen drückten
so eigene Geltung nach Erneuerung des westlichen Kaisertums aus,
auch Salier und Staufer sollten dieser Tradition folgen.
Herrscherkleidung
musste in der Öffentlichkeit beredt sein und konnte deshalb
auch völkische Elemente beinhalten, wie von Karl
I. (d
Gr) oder Otto
I. (reg
936-973) bekannt. Kurze Tunicaformen blieben dem einfachen Volk
behaftet, vom Adel als „altfränkisch“
= unmodern angesehen.
Von der Herrschergattin wurden eher aufwändige Extravaganzen
erwartet, von ihrem Ehemann nicht zwingend, da Tradition in seinem
Fall äusserlich sichtbares Zeichen der Stabilität
bedeutete! Neue Moden stammten vielfach aus Italien, das unter
oström Einfluß stand. Byzantinische Sitten und Mode
fanden ihren Weg über die Alpen, unter den Sachsen nicht
zuletzt durch die Heirat Ottos
II. (reg
973-83) mit der byzant. Kaisernichte Theophanu
972, welche mglw nicht
unerheblich an Ottos Rom-Idee wirkte Italien als Mittelpunkt des
neuen „Sacrum
Imperiums“ zu sehen.
Man vermutet, dass Seidengewebe mit sassanidischen Motiven, wie
der „Elefantenstoff“ im Karlsschrein zu Aachen aus dem
Brautschatz von Theophanu stammten, der Mutter Ottos
III. (reg
983-1002), jener ließ im Jahr 1000 das Karlsgrab öffnen
und das Tuch über die Gebeine breiten, siehe auch
ROM-Byzanz-Seide-Italien.
Byzant.-italienischer
Einfluß auf karoling.-ottonische „Prachtmode“:
Kleidung
unterer Volksschichten war germanisch und die der Kleriker
spätantik geprägt, wobei sakrale Kult-Tracht ehrwürdiges
Alter, Privilegien und Unantastbarkeit ausdrückte. Auch
Herrscher folgten antiken Traditionen, um Legimation oder
Ansprüche zu verdeutlichen, so wusste man sich in besonderen
Repräsentationsmomenten standesgemäß „römisch“,
bzw „griechisch“ zu kleiden. Bereits Karl
I. (d
Gr.) war am Weihnachtstag 800 in Rom nicht in „fränk.
Tracht“, sondern mit langer Tunica und der „chlamys“,
dem röm-hellenistischen Mantel, erschienen. Während der
Krönungszeremonie warf Karl die „chlamys“
ab und schwang sich das
purpurfarbene Ornat des oström Kaisers über. Auch sein
Enkel Karl II.
(d Kahle
843-77) verfuhr so, zur Kaiserkrönung in Rom trug er 875/76
anläßlich der Kirchenversammlung ein Gewand mit
dalmatischem Talar. Bei Ankunft in Rom war Karl noch in „fränk.
Tracht“ eingeritten.[3]
Beide
provozierten
mit der „griechischen Gewandung“ bewußt,
formulierten ihren Machtanspruch in Anlehnung an das oström
Kaiserhaus, was sich brüskiert sehen musste, denn der
Basileus
in
Konstantinopel verstand sich als einziger legitimer Nachfolger der
Caesaren. Bereits merowingische Goldmünzen mit eigenem
Herrscherabbild galten als Affront und Angriff auf die Stellung
des oströmischen Kaisers. Franken und Ottonen drückten
so eigene Geltung nach Erneuerung des westlichen Kaisertums aus,
auch Salier und Staufer sollten dieser Tradition folgen.
Herrscherkleidung
musste in der Öffentlichkeit beredt sein und konnte deshalb
auch völkische Elemente beinhalten, wie von Karl
I. (d
Gr) oder Otto
I. (reg
936-973) bekannt. Kurze Tunicaformen blieben dem einfachen Volk
behaftet, vom Adel als „altfränkisch“
= unmodern angesehen.
Von der Herrschergattin wurden eher aufwändige Extravaganzen
erwartet, von ihrem Ehemann nicht zwingend, da Tradition in seinem
Fall äusserlich sichtbares Zeichen der Stabilität
bedeutete! Neue Moden stammten vielfach aus Italien, das unter
oström Einfluß stand. Byzantinische Sitten und Mode
fanden ihren Weg über die Alpen, unter den Sachsen nicht
zuletzt durch die Heirat Ottos
II. (reg
973-83) mit der byzant. Kaisernichte Theophanu
972, welche mglw nicht
unerheblich an Ottos Rom-Idee wirkte Italien als Mittelpunkt des
neuen „Sacrum
Imperiums“ zu sehen.
Man vermutet, dass Seidengewebe mit sassanidischen Motiven, wie
der „Elefantenstoff“ im Karlsschrein zu Aachen aus dem
Brautschatz von Theophanu stammten, der Mutter Ottos
III. (reg
983-1002), jener ließ im Jahr 1000 das Karlsgrab öffnen
und das Tuch über die Gebeine breiten, siehe auch
ROM-Byzanz-Seide-Italien.
4a Gürtelrekonstruktionen auf Reichsgebiet, West-Slawen und Haithabu
Haithabu fungiert hier aufgrund seines Fundguts als Bindeglied zwischen der skandinavischen und westslawischen Welt zum karoling-otton. Reichsgebiet. Den Aufstieg verdankte es der Zwangsumsiedlung slawischer Kaufleute aus Rerik durch den dän. Kg Göttrik (gest 810) an die Schlei mit strategisch günstiger Lage unweit des Heerwegs nach Jütland, eine dänisch-karolingische Konfliktzone. Der Raum sollte umstritten bleiben. Ludwig I. (d Fromme 814-40) mischte sich in die dän. Thronwirren und sorgte für die Taufe Harald Klaks (gest 852). Kg Heinrich I. (919-36) eroberte Haithabu 934 und förderte die Missionierung bis in den Norden Jütlands. Ein arab. Kaufmann und Gesandter berichtete um 965, dass die Anzahl der Christen in Haithabu allerdings gering sei. Rund 50 Jahre lang gab es dort einen sächs. Markgrafen, aus dieser Zeit stammt der heute sichtbare Halbkreiswall. Nach dän. Machtübernahme 983 blieb der Ort bis zu seinem Untergang 1066 Zankapfel zwischen dän., schwed. und norwegischen Herrschern.
Obwohl Grabausstattung für „Ottonen“ ohne Belang, sei zu Slawen und Haithabu verwiesen auf die Kategorie A-E unter Gesellschaftsstrukturen des FMAs
VIII
-
XI
-
Haithabu
- Ausgewählte Funde aus der Sdlg und den Gräbern -
[Abb. nach Schietzel, Spurensuche Haithabu, S. 197]
Die Funde aus den Siedlungsgrabungen zeigen vielfach unspektakuläre eiserne Schnallentypen ohne Beschlagbleche meist Pferdegeschirr, im Bootkammergrab befanden sich auch welche mit Blechen. Von den bis 1970 rund 1350 untersuchten Gräbern enthielten rd 20% Beigaben, bislang wurden weniger als 30 Gürtelobjekte geborgen, meist Bronze, einige davon vergoldet, nur zweimal aus Silber. Davon waren 3 Gräber durch Perlen weiblichen Toten zuzuordnen. Reichhaltig ausgestattete Gräber gab nur noch wenige, die 15 untersuchten Kammergräber waren vielfach massiv beraubt [HAI, S. 125ff]. Manche der Schnallen werden als Taschenverschlüsse bezeichnet, was aber nicht so sein muss. Die stark verkrustete ovale Schnalle aus Gr128 bsplw hat ein Außenmaß von 33 mm Breite (!) und eine Riemendurchzugbreite von ca. 22 mm, was durchaus anderen Gürtelteilen entspricht. [Im Katalog von Arents/Eisenschmidt verwirren die Breiten- und Längenangaben der Schnallen. Sie sind genau umgekehrt wie man es als Anwender eigentlich erwartet. Es ist sinnvoll das Außenmaß einer Schnalle sowie das Innenmaß als Durchzug des Riemens in der Breite quer anzugeben. Die Länge wäre demnach längs mit Blech- und Außenmaß und mögliche „Durchlaßhöhe“. Das ist in der Anwendung logisch und wird in den meisten Publikationen auch so gehandhabt, nur Arents/Eisenschmidt weichen leider in ihrer ansonsten sehr verdienstvollen Arbeit von diesem Schema ab]. Die letzten Sondenbegehungen des Geländes brachten zahlreiche Neufunde hervor, momentan noch unpubliziert. Es erwarten uns also noch einige Überraschungen.
Für schlichte „Haithabu-Darstellungen“ siehe Gürtel mit Eisenschnallen mit Grabnummern, ansonsten für die Frühphase Gürtel der Karolingerzeit (z.B. FrGr 497). Alle Objekte können durch Oberflächenvergütung in Gold höheren Darstellungen (A) gerecht werden, zu den Kategorien A-E im Detail siehe: Gesellschaftsstrukturen des FMAs
-
Haithabu / West-Slawen
Schnalle und Zunge rechts aus Hb Gr59 FGF, Original Bronze, hier Messing, Lederreste an der Kombi im Grab nachweisbar. Ganz rechts Variante mit Zunge Typ „Menzlin“, Detailbild Riemenende mit ähnlicher Form aber unbekannter Herkunft.
[Veredelung in Gold mgl für A]
-
X_XI_008a_me
30 mm Riemen (natur/braun/rot)
und Zunge „Haithabu“_me
montiert 149,00 EUR
-
X_XI_008tb_me [Detailbild Zunge 008tc]
30 mm Riemen (natur/braun/rot)
und Zunge Typ „Menzlin“_me
montiert 129,00 EUR
-
Haithabu
-
![]()
 Schnalle
aus Hb Gr286 FGF, im Original Bronze vergoldet. Keine Zunge im
Grab, deshalb mögliche Variante ergänzt mit schlichtem
unverziertem Beschlag/Zunge aus Hb Gr32 FGF oder ganz rechts
Annäherung an Siedlungs-Fund Hb.
Schnalle
aus Hb Gr286 FGF, im Original Bronze vergoldet. Keine Zunge im
Grab, deshalb mögliche Variante ergänzt mit schlichtem
unverziertem Beschlag/Zunge aus Hb Gr32 FGF oder ganz rechts
Annäherung an Siedlungs-Fund Hb.
-
X_042ee_bz [Detailbild Zunge länglich]
25 mm Riemen (natur/braun/rot)
und mögliche Zunge ohne Zier_bz
montiert 129,00 EUR
-
X_042ta_bz
25 mm Riemen (natur/braun/rot)
und Zunge Typ Flecht_bz
montiert 129,00 EUR
-
Haithabu / West-Slawen
Schnalle rechts aus Hb BrGr347 SGF-W, im Original Eisen, ganz rechts Typ Starigard, beide mit möglichen Zungen ergänzt in Annäherung an ähnliche Haithabu-Form mit speziellem westlich verbreitetem Kettenringgeflecht in Doppelstreifen, Zunge im original etwas länger und spitz zulaufend.
[Veredelung in Gold mgl für A]
In Haithabu viele erhaltene Schnallentypen recht schlicht, gemessen an verzierten Fibelformen oder deren Arbeits-Patrizen.
-
X_012te_me
20 mm Riemen (natur/braun/rot)
und mögliche Zunge mit Zier_me
montiert 110,00 EUR
-
X_013te_me
20 mm Riemen (natur/braun/rot)
und mögliche Zunge mit Zier_me
montiert 110,00 EUR
-
Haithabu
 Schnalle
und Zunge rechts als Buntmetall-Variante nach dem Fund aus Eisen
Hb BrGr347 SGF-W. Ganz rechts ergänzt mit möglicher
Zunge oder Beschlag aus Hb Sdlg, im Original Bronze vergoldet.
Schnalle
und Zunge rechts als Buntmetall-Variante nach dem Fund aus Eisen
Hb BrGr347 SGF-W. Ganz rechts ergänzt mit möglicher
Zunge oder Beschlag aus Hb Sdlg, im Original Bronze vergoldet.

-
IX-X_012e_bz
20 mm Riemen (natur/braun/rot)
und Zunge 4,5 x 2 cm_bz
montiert 129,00 EUR
-
X_012a_bz [Detailbild X_013a]
20 mm Riemen (natur/braun/rot)
und mögliche Zunge 7 x 2 cm_bz
montiert 129,00 EUR
-
Haithabu / West-Slawen
 -Die
Kombination rechts ist wohl so bei Arents/Eisenschmidt gelistet,
aber mit dem Vermerk, dass im Laufe der Zeit die Haithabu
Grabinventare 230 und 231 unabsichtlich zusammen gefügt
wurden. Die Stabzunge der „Variante 2“ fand sich auch
in den Hb Gräbern 562, 741 und 1082.
-Die
Kombination rechts ist wohl so bei Arents/Eisenschmidt gelistet,
aber mit dem Vermerk, dass im Laufe der Zeit die Haithabu
Grabinventare 230 und 231 unabsichtlich zusammen gefügt
wurden. Die Stabzunge der „Variante 2“ fand sich auch
in den Hb Gräbern 562, 741 und 1082.
Gleitringe, ganz rechts Starigard Gr19, waren bei diesen Kombinationen üblich und sind auch für Haithabu voraus zu setzen nach Fund aus der Sdlg und Guß-Form zur Stabzunge „Variante 4“.
-
X_014z_Hb me [Detailbild bz]
15 mm Riemen (natur/braun/rot)
und Stabzunge Hb „Variante 2“
montiert 79,00 EUR
-
X_Rg mit Stabzunge St „Variante 4“_me
18 mm Riemen (natur/braun/rot)
montiert 79,00 EUR
-
Reichsgebiet / West-Slawen
-
Beide Schnallentypen bereits seit der späten MWZ üblich und bis in X. Jh verwendet, rechts z.B. durch Fund in Birka, ganz rechts in Haithabu zu belegen, Zungen/Ort in beiden Fällen Starigard.
[Probebilder - Beschlagblech noch nicht gebohrt]
-
X-XI_007ad / [Detailbild: 009ad]_bz
20 mm Riemen (natur/braun/rot)
und mögliches Ort_bz
montiert 99,00 EUR
-
IX-XI_012ay_bz oder me
18 mm Riemen (natur/braun/rot)
und mögliche Zunge_bz oder me
montiert 99,00 EUR
-
Reichsgebiet / West-Slawen
-
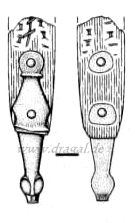 Auch
diese beiden Schnallentypen bereits seit der späten MWZ
üblich und bis in X. Jh verwendet, rechts z.B. durch Funde in
Birka, ganz rechts in Starigard zu belegen. Hier verwendete Zunge
in Abwandlung Starigard oben mit Strichgravur versehen, ähnlich
z.B. bei dem „Gandersheimer Kästchen“ und
weiteren Funden bis zur Wende X./XI. Jh, feiner als beim
Jellinge-Stil.
Zunge mit Tierkopf und Kreuz verbreitet in
Osteuropa, aber auch auf Reichsgebiet waren solche Tiermuster noch
durchaus geläufig.
Auch
diese beiden Schnallentypen bereits seit der späten MWZ
üblich und bis in X. Jh verwendet, rechts z.B. durch Funde in
Birka, ganz rechts in Starigard zu belegen. Hier verwendete Zunge
in Abwandlung Starigard oben mit Strichgravur versehen, ähnlich
z.B. bei dem „Gandersheimer Kästchen“ und
weiteren Funden bis zur Wende X./XI. Jh, feiner als beim
Jellinge-Stil.
Zunge mit Tierkopf und Kreuz verbreitet in
Osteuropa, aber auch auf Reichsgebiet waren solche Tiermuster noch
durchaus geläufig.
[Veredelung in Silber mgl für A]
-
X-XI_009axa / [Detailbild: 007axa]_bz
20 mm Riemen (natur/braun/rot)
und mögliche Zunge_bz
montiert 129,00 EUR
-
IX-XI_013axb / [Detailbild: 013axa]_bz oder me
20 mm Riemen (natur/braun/rot)
und mögliche Zunge_bz
montiert 129,00 EUR
-
Von Byzanz aufs Reichsgebiet / West-Slawen
-Schnallen mit „abgesetztem Steg“ bedürfen keines Dornschlitzes und haben eine interessante Geschichte: Frühe Formen aus Ostasien um Christi Geburt (nach westl Zeitrechnung), Transfer über Reitervölker und Verbreitung über Byzanz im Westen bis ins HMA. Die „vorspringende Dornachse“ erinnert an Schnallen der RKZ. Mögliche Zunge „Greif“ nach einem Steigbügelbeschlag im LM Mainz, Beutestück aus den Magyaren-Kriegen nach erfolgreichen Abwehrschlachten wie Riade oder Lechfeld mit Auszeichnung des Gefolges...der Ursprung des Motivs liegt im Vorderen Orient, durch Reitervölker und Byzanz im Westen verbreitet.
[Veredelung in Silber mgl für A]
-
X-XI_001b_bz
18 mm Riemen (natur/braun/rot)
und mögliche Zunge_bz
montiert 99,00 EUR
-
X-XI_002b_me
20 mm Riemen (natur/braun/rot)
und mögliche Zunge_me
montiert 99,00 EUR
4b - Gürtel mit Eisenschnallen VIII.-XI. Jh [D-E]
 Eisen,
aus Rennöfen gewonnen, musste durch Ausheizen und Schlagen
erst von Verunreinigungen befreit werden. Mit Handhämmern
wurde es zu viereckigen, relativ weichen, kohlenstoffarmen Barren
(„Osemund-Stäbe“) geformt und ging als Halbzeug
in den Handel. Es war ein schmiedbares Schweißeisen, meist
mit weniger als 0,1% Kohlenstoff-Anteil, nur vereinzelt zeigen
Funde eine Verstählung mit über 0,5% Anteil. War der
Gehalt zu hoch, wurde das Eisen spröde und brach leicht, war
er zu niedrig verbog es sich, was über minderwertige Klingen
berichtet wird. Alle unten aufgeführte Formen sind geeignet
für schlichte Darstellungen sowie militärische Zwecke.
In Haithabu
wurden
Eisenschnallen bislang aus den Gräbern 347, 460, 556, 852,
861 geborgen und aus dem BoKaGr vom Pferdegeschirr, wozu wohl auch
einige Funde aus dem Siedlungsbereich zählen werden, vor
allem breite Formen. In Grimstrup Reitergrab A im SW Dks lagen
Schnallen bis zu 7 cm Breite vor [Stoumann, Ryttergraven fra
Grimstrup, S166]. Große Mengen an Holz benötigte man in
der Eisenproduktion. Im SMA gelang ein Durchbruch in der
Stahlerzeugung mit Nutzung der Wasserkraft für den Betrieb
von Blasebälgen und Hämmern, siehe Exkurs
Eisenproduktion
vom HMA zum SMA.
Eisen,
aus Rennöfen gewonnen, musste durch Ausheizen und Schlagen
erst von Verunreinigungen befreit werden. Mit Handhämmern
wurde es zu viereckigen, relativ weichen, kohlenstoffarmen Barren
(„Osemund-Stäbe“) geformt und ging als Halbzeug
in den Handel. Es war ein schmiedbares Schweißeisen, meist
mit weniger als 0,1% Kohlenstoff-Anteil, nur vereinzelt zeigen
Funde eine Verstählung mit über 0,5% Anteil. War der
Gehalt zu hoch, wurde das Eisen spröde und brach leicht, war
er zu niedrig verbog es sich, was über minderwertige Klingen
berichtet wird. Alle unten aufgeführte Formen sind geeignet
für schlichte Darstellungen sowie militärische Zwecke.
In Haithabu
wurden
Eisenschnallen bislang aus den Gräbern 347, 460, 556, 852,
861 geborgen und aus dem BoKaGr vom Pferdegeschirr, wozu wohl auch
einige Funde aus dem Siedlungsbereich zählen werden, vor
allem breite Formen. In Grimstrup Reitergrab A im SW Dks lagen
Schnallen bis zu 7 cm Breite vor [Stoumann, Ryttergraven fra
Grimstrup, S166]. Große Mengen an Holz benötigte man in
der Eisenproduktion. Im SMA gelang ein Durchbruch in der
Stahlerzeugung mit Nutzung der Wasserkraft für den Betrieb
von Blasebälgen und Hämmern, siehe Exkurs
Eisenproduktion
vom HMA zum SMA.
--
Eis_20 oval rundstabig
20 mm Riemen (natur/braun) ohne Zunge
angenäht 39,00 EUR
-
Eis_20 flachstabig
20 mm Riemen (natur/braun) ohne Zunge
Schnalle angenäht 39,00 EUR
-
Eis_25 quadratisch
25 mm Riemen (natur/braun) ohne Zunge
Schnalle angenäht 49,00 EUR
-
Eis_30 oval rundstabig
30 mm Riemen (natur/braun) ohne Zunge
Schnalle angenäht 55,00 EUR
-
Eis_30 flachstabig
30 mm Riemen (natur/braun) ohne Zunge
Schnalle angenäht 49,00 EUR
-
Eis_30 flachstabig mit Schnallenblech
30 mm Riemen (natur/braun) ohne Zunge
Schnalle angenietet 75,00 EUR
-
Zur Einführung die Zeitenwanderung: … Die Nacht war endlich vorüber, feucht und scheinbar ohne Ende. Immer wieder hatte es geregnet, wie auch die Nächte zuvor, die Hände klamm, die Finger steif und Wasser perlte vom Haar …
-
Historischer Kontext IX.-XI.Jh:
Die Besiedlung Skandinaviens setzte in der Jungsteinzeit ein, da der Golfstrom für ein erträgliches Klima sorgte. Blieb der hohe Norden nomadisch geprägt, gab es im Süden Entwicklungen analog zum Kontinent von Megalithkultur zur Hügelgräber-Bronzezeit und Übergang zu Brandgräbern. Felszeichnungen mit Jagd-Darstellungen muten schamanistisch an, Schiffs- und Kriegsszenen geben in Zusammenhang mit bootsförmigen Steinsetzungen erste Hinweise auf soziale Hierarchien. Doch sorgten im Übergang zur Eisenzeit wiederholt starke klimatische Schwankungen mit Auswirkung auf Flora und Fauna zu Brüchen in Wirtschaft, Mode und Sitten und im Extremfall zu Auswanderungen, stellvertretend seien Kimbern und Goten genannt, aber auch weitere südgerman. Stämme haben ihre Wurzeln im Norden. Eisen konnte anfangs nur aus Moorerzen gewonnen werden und blieb lange, wie Kupfer, begehrtes Importgut, schuf vielfältige Kontakte zum römisch dominierten Kontinent. Die Heeresbeute-Opferplätze Südskandinaviens des II.-IV. JhsAD zeugen vom Gebrauch röm Ausrüstung. Für das MA konnten inzwischen Produktionsstätten für Eisen analysiert werden, es wurde bald darauf exportiert – Aussagen zu Kupfer schwierig, da nicht exakt gesichert, seit wann z.B. so reichhaltige Lagerstätten wie das schwed. Falun ausgebeutet wurden.[4]
Die folgenden Betrachtungen differenzieren zwischen einem westlichen Kreis rund um die Nordsee (NW, Dk, Danelag), der schwedischen Region und dem östlichen Kreis von Gotland zu den Rus.
Das nordische Erbrecht und Gesellschaftssystem mit Gefolgschaften verlangte den Beutezug und gab nicht erbberechtigten Nachgeborenen ein Auskommen. Mit Hilfe der Schiffe konnte man die Radien erheblich erweitern. Um 800 begannen sporadische Seeangriffe von Norwegern auf die britische und irische Küste und bald folgten Dänen gegen die kontinentale Kanalküste. Durch Händler erfuhr man von den Verhältnissen im Frankenreich und Herrscherwechsel ermutigten zu raids auf die Quellen fränkischen Reichtums [s.o.]. In den 830ern häuften sich die Attacken und ab 840 in der Schwächephase nach dem Tod Ludwigs I. waren Städte weit im Westen des Frankenreichs betroffen, 845 Paris und im gleichen Jahr das gerade erst zum Erzbistum ernannte Hammaborch an der Elbe. Man schloss sich zu großen Unternehmungen zusammen, denn so gelang es hohe Geldsumme von den Drangsalierten zu erpressen. Nicht immer geschah die Beteiligung an diesen Fahrten freiwillig. Das fries. Landrecht § 20 schildert, wie mit denjenigen zu verfahren sei, welche von den Nordmannen verschleppt und zu Raubfahrten gezwungen wurden. 865 fiel ein gr. Nordisches Heer in Ostengland ein und brachte weite Gebiete unter Kontrolle. 879 setzte es nach Nordfrkrch über, nutzte erneut fränk. Thronwirren und plünderte die nächsten 13 Jahre zahlreiche Orte bis an Mosel, Maas und Rhein.
Der Ostseeraum wurde geprägt vom Handel mit intensiver Küstenseefahrt, die sich von der Hochseefahrt insoweit unterschied, dass verstärkt Schären, Seen und Flüße befahren wurden, was dem Ruder einen hohen Stellenwert verlieh. Schwedische Waräger folgten den Spuren ihrer gotischen Vorfahren, die bereits lange zuvor tief in osteurop. Weiten vorgedrungen waren, die Wege gerieten nicht in Vergessenheit. Auf geruderten Flußbooten wurden monatelange Reisen unternommen, um Zargrad-Byzanz zu erreichen oder man betrieb Etappenhandel mit Waren aus dem Orient, legte befestigte Siedlungen an und begründete Herrschaftsgebiete. Die Rus-Reiche nahmen Elemente der slawischen, byzantinischen und nomadischen Kultur auf.
-
-
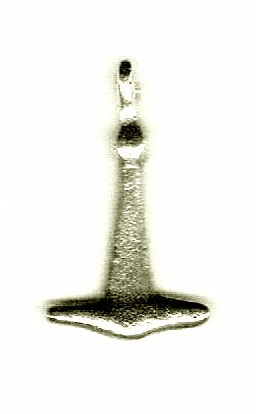
-
„Mjölnir
wurd die Waffe / Thors genannt
weit im Wurf / Riesen übermannt
Heil Dir Thor / Segner der Saaten
Ruhmreich raunen / des Asen Taten
Skalden Sang / im Edda-Liede
Siege was aus / Zwergen Schmiede.
Seid Ihr einst / zu Sternen Stunde
geladen Gast / in Walhalls Runde
zählet dann zu / Thors Gesinde
bevor der Christen Gott Euch binde.“
[...wohl anstabend und mit Endreim, doch fehlt die Wortgewalt der Skalden-Kraft]
-
Wikingerzeit IX.-XI. Jh
eis = Eisen, me = Messing, bz = Bronze, vs = versilbert, si = Silber, vg = vergoldet
FO = Fundort, AO = Aufbewahrungsort, ae = ähnlich,
KaGr = Kammergrab, BrGr = Brandgrab
Die Anführer der raids konnten ihr Gefolge nur bei entsprechender Entlohnung halten. Der enge Kern bestand aus einer Leibwache, die sich auch reiche Grundherren und wohlhabende Kaufleute leisteten, die mit überdurchschnittlicher Ausrüstung ihre Mannen zufrieden stellten. „Treueschwur - Beute - Geschenk“ galten als Kittmasse in einem komplizierten Beziehungsgeflecht. Geben und Nehmen hatte zeremoniell verpflichtenden Charakter, siehe Hundertschaft-Gefolgschaft-Lehnswesen.
5. Quellen für die „Wikingerzeit“:
Aufgrund der klimatischen Verhältnisse gab es in Nordeuropa recht eigenständige modische Entwicklungen, trotz mancher Modewellen, welche den Norden nicht selten aus dem dänischen Raum erreichten, dessen Einfluss sich bis nach Norwegen und Schweden erstreckte. Grabbeigaben dokumentieren, dass Sachgüter des Kontinents übernommen, nach ästhetischem Empfinden durch Feinschmiede, aurificis umgeformt wurden, um das Ansehen der Auftraggeber zu mehren, gilt vor allem für Standessymbole der kontinentalen Elite. Ähnlich wie einst das Röm Reich im „Freien Germanien“ wirkte, übten Objekte der fränk. und angelsächs. Kultur auf Nordgermanen Anziehungskraft aus. Wäre dem nicht so gewesen, hätte man sich die Beutezüge sparen können! Hinzu kam die Ware Mensch, denn mit Sklaven war gutes Geld zu machen, Dublin z.B. wurde nach 841 einer der größten Sklavenmärkte Europas, zeitgleich mit Verdun (!). Während Gräberfelder der MWZ auf dem Kontinent bis ins VIII. Jh reichhaltige Grabensembles aufwiesen, verebbte dies mit Beginn der Christianisierung. Das traf mit zeitlicher Verzögerung auch die Kulturen der europ. Randzonen. Bis dahin dokumentieren Grab- und Hortfunde aus Skandinavien und Osteuropa einen breiten Formenreichtum. Dazu kommen Siedlungsfunde aus den küstennahen Handelszentren, wovon rund 30 in Skandinavien bekannt sind, darunter Nidaros/Trondheim, Skíringssalr/Kaupang, Ripa/Ribe, Sliesthorp/Heddeby/Haithabu, Helgö und Björkö/Birka und rund 10 entlang der slaw Ostseeküste z.B. Alt Lübeck, Oldenburg/Starigard, Groß Strömkendorf, Dierkow an der Warnow (Rostock), Ralswiek auf Rügen, Menzlin an der Peene, Wolin in der Oder- und Truso bei Elblag nahe der Weichselmündung im Übergang zu den bislang rund 6 baltischen Orten, als Handelswege zu den Rus. Wiskiauten lag wohl einst an der Memel-Mündung, heute am Frischen Haff und Kurischen Nehrung oder über den Fluß Alanda wurde der Ort Grobin in Lettland angesteuert. In diesen polyethnisch besiedelten Orten veränderten sich die Gesellschaftstrukturen massiv. Handwerk wurde eigenständig und war nicht mehr an die Fürstenhöfe gebunden, der Handel brachte eine reiche Kaufmannschicht hervor, welche begann Mode(n) zu prägen, eine städtische Oberschicht entwickelte sich. Manche der aufgeführten Orte erlebten die Jahrtausendwende nicht, da sie aufgrund der Lage an Flüssen und Seen im Landesinneren nur von kleineren Schiffen angelaufen werden konnten. Doch Tonnage und Tiefgang der seegängigen Transporter nahmen zu, in Haithabu mit kontinuierlichem Ausbau der Landungsbrücken gut zu beobachten, Flachwasserhäfen hatten das Nachsehen...
Gürtel zählen zur WKZ nicht zu den häufigen Grabbeigaben, nur Gotland zeigt ein hohes Fundspektrum. Vor allem aus Frauengräbern fehlen Gürtelreste aus Metall. Daraus kann man keineswegs schließen, dass Frauen keine Gürtel trugen [Geijer Birka III, S. 153]. Eine so spezifische Quellengattung wie Grabinhalte haben eben nur eingeschränkte Aussagewerte. Bei Brandgräber mit ihren besonderen Riten wird das sofort klar. Aber auch sonst sind die Inventare kein „Spiegel des Lebens“, sondern stellen eine intentionelle Auswahl dar, siehe Gesellschaftsstrukturen des FMAs. Gräber liefern zur Frage der Gürtelnutzung also nur wenig Erkenntnisse. Erhalten sind kleine gegürtete Frauen-Statuetten und in Haithabu weisen Abriebspuren am Fragment eines Trägerrocks auf einen Gürtel hin. In Sagas wird von einem Kleid berichtet, das seine Trägerin in der Taille schnürte, ohne den Gürtel explizit zu erwähnen, im Rigsmal der Edda eine „Gürtelschlanke“erwähnt. Als Denkmodell sind gebundene Stoffgürtel nicht ausgeschlossen. Diese vergehen wie die Kleidung und bleiben in Körpergräbern nur nachweisbar durch den Kontakt mit Metallen, siehe Textilreste. Momentan scheint die Menge an bunten Stoffborten im Reenactment bei Männern Auswuchs moderner Mode-Torheiten zu sein, schlichte Stricke wären glaubhafter, oder man bleibt beim Leder. Snorri Sturluson schildert die schwierige Geburt von Olaf II. im Jahr 995. Hrani, ein alter Weggefährte von Olafs Vater legte im magischen Ritual der kreissenden Mutter Asta den Gürtel eines verstorbenen Ahn auf den Bauch und die Geburt gelang, nach germanischer Sitte durch Übertragung des Heils der Sippe auf das Neugeborene. Der kostbare Gürtel wurde in hohen Kreisen demnach eine zeitlang aufbewahrt und nicht „funeral entsorgt“. Noch Anf des XVI. Jhs wurden solche Kräfte dem Gürtel des Hl. Luidger in der Abtei Werden/Ruhr zugesprochen.
 Zum
Jahr 987 verzeichnet die
Nestorchronik ein interessantes Detail als Fürst Wladimir von
Kiew Botschafter zu benachbarten Völkern schickte, um deren
Religionsausübung zu prüfen. Die Gesandten zu den
Bulgaren berichteten, dass jene Kultfeiern in Gotteshäusern
ohne angelegte Gürtel ausführten; erstaunlich, dass man
dies erwähnenswert fand. Aber an den Silber beschlagenen
„Reitergürteln“ waren Bogenköcher, Säbel
und Taschen angelascht, deshalb legte man wohl alles zusammen ab.
Auch nordische heilige Stätten wurden ohne Waffen betreten
und gleichfalls, wohl unter Aufsicht, deponiert. Noch im XIV. Jh
war an schwed. Kirchen das sogenannte Vapenhus
angeschlossen, wie an der Südseite des Langhauses der Kirche
von Dalby im Süden von Skane/Schonen, in welchem
Kirchenbesucher sich der Bewaffnung entledigten und Waffengurte
selbstverständlich abschnallten.
Zum
Jahr 987 verzeichnet die
Nestorchronik ein interessantes Detail als Fürst Wladimir von
Kiew Botschafter zu benachbarten Völkern schickte, um deren
Religionsausübung zu prüfen. Die Gesandten zu den
Bulgaren berichteten, dass jene Kultfeiern in Gotteshäusern
ohne angelegte Gürtel ausführten; erstaunlich, dass man
dies erwähnenswert fand. Aber an den Silber beschlagenen
„Reitergürteln“ waren Bogenköcher, Säbel
und Taschen angelascht, deshalb legte man wohl alles zusammen ab.
Auch nordische heilige Stätten wurden ohne Waffen betreten
und gleichfalls, wohl unter Aufsicht, deponiert. Noch im XIV. Jh
war an schwed. Kirchen das sogenannte Vapenhus
angeschlossen, wie an der Südseite des Langhauses der Kirche
von Dalby im Süden von Skane/Schonen, in welchem
Kirchenbesucher sich der Bewaffnung entledigten und Waffengurte
selbstverständlich abschnallten.
Exkurs Schiff: Norwegen ist untrennbar mit ihm verbunden, viele Orte an der zerklüfteten Küste waren nur zur See erreichbar. Nicht viel anders begünstigten die 500 Inseln Dänemarks oder das gewässerreiche Schweden mit seinen Seen und Schären eine ausgeprägte Schiffahrt. Nordischer Bootsbau ist durch Felszeichnungen seit der Bronzezeit nachweisbar. Das Hjortspring-Boot (EZ um 350vC) von der Insel Alsen (Dk) hatte Planken und Spanten mit Bastschnüren vernäht, keine Segel und wurde gepaddelt, wie es Tacitus zu den Schiffen der im Osten siedelnden Suionen „lose Ruder“ und „Nutzung wie auf Flüssen“ erwähnt [Germ, Kap 44]. Ein Jahrtausend später vermittelte skand. Schiffsbau hohe Professionalität, dokumentiert mit den Grabfunden im norweg. Oseberg (1.H. IX. Jh) und Gokstad (Wende IX./X. Jh). Die Beigaben sind erwähnenswert mit Details zur Stellung der Frau in Oseberg oder zu Vorlieben des Bestatteten in Gokstad mit Möbeln, Schlitten, 8 Hunden, Textilien sowie 12 Pferden, welche das Schiff auf Land gezogen hatten und im Ritus geopfert wurden. Schiffe dominierten lange Zeit wirtschaftliches und politisches Denken - keine Zivilisation ohne gute Verkehrsanbindung.[5] Das betraf in erster Linie Ortschaften in Küsten- oder mit Flußlage, was sie allerdings Begehrlichkeiten aussetzte, falls Personen nicht bereit waren für Güter entsprechende Gegenwerte zu entrichten. Flüsse bestimmten strategisches Denken, das sieht man an der Wahl der Reichsgrenzen Roms und Vormarschrouten seiner Armeen, der Versorgung dienend. Nicht ohne Grund begann Karl I. (d Gr) unter immensem Aufwand mit dem Kanalbau zwischen Main und Donau als er gegen die Awaren zu Felde zog, siehe auch Heer- und Handelswege im Mittelalter.
 Bereits
zur röm Kaiserzeit unternahmen Völker der Nordseeküste
(Sachsen,Friesen) Beutezüge per Schiff gegen die Küsten
Britanniens und Galliens. Zeitgleich fanden Angriffe auf die
jütländische Küste durch Völker aus
Südschweden statt, welche man später „Dänen“
nannte.
Dafür genutzt wurde ein geruderter Schiffstyp wie Nydam
B
(Fund
nahe Alsen-Sund c320 AD), eine mit Eisennägeln geklinkerte
Schalenbauweise, die Plankengänge mit Zurrklampen an den
Spanten festgelascht, ohne
Segel, mit Ruder in Dollen,
siehe Mooropferfunde
mit Heeresausrüstung
(z.B.
Illerup Adal, Thorsberg, Kragehul). Vielleicht
beschleunigte der Druck aus dem Osten eine Umsiedlung von Jüten
und Angeln nach Britannien? Man kannte die Insel gut und einige
von ihnen leisteten dort Dienst als Foederaten im spätröm.
Heer um 400. Familien zogen nach und Jüten hinterliessen
Spuren als Siedler in Kent. Nach Abzug der röm Armee war die
britische Bevölkerung aus Norden und Westen
piktisch-irisch-walisischen Angriffen ausgesetzt und nötigte
sie wohl german. Kontingente anzuwerben. Vermutlich war die
Bezahlung ein Problem. Es kam zu Aufständen der Söldner.
Sie unterwarfen die Einheimischen und etablierten eigene
Herrschaftsbereiche. Im VII. Jh gab es durch die Christianisierung
von
Süden aus zahlreiche Verbindungen zum fränk. dominierten
Kontinent, was eine Angleichung
der angelsächs. Mode
bewirkte.
Zu den Schiffstypen, wie sie in Gräbern aus Sutton
Hoo oder
Snape
in
East Anglia (ca 600-625 AD) überliefert sind heißt es
allgemein, dass über Besegelung keine Aussage möglich
sei, da sich nur die Schiffsformen durch Klinkernägel
erhielten. Segel erfordern einen starken Kiel, die Bauweise oben
genannter dänischer Küstenruderer war dafür
ungeeignet. Aber Nordseeanrainer kannten Segel seit römischen
Zeiten. Angel, Sachsen und Jüten werden Segel bei ihren
Überfahrten genutzt haben (!), der Chronist Gildas
(gest.
570) erwähnt ganz eindeutig Segel an den cuyls
der Barbaren. Also
ist „Nydam“
ein
Holzweg, der seit langem in der Forschung beschritten wird - Warum
?
Bereits
zur röm Kaiserzeit unternahmen Völker der Nordseeküste
(Sachsen,Friesen) Beutezüge per Schiff gegen die Küsten
Britanniens und Galliens. Zeitgleich fanden Angriffe auf die
jütländische Küste durch Völker aus
Südschweden statt, welche man später „Dänen“
nannte.
Dafür genutzt wurde ein geruderter Schiffstyp wie Nydam
B
(Fund
nahe Alsen-Sund c320 AD), eine mit Eisennägeln geklinkerte
Schalenbauweise, die Plankengänge mit Zurrklampen an den
Spanten festgelascht, ohne
Segel, mit Ruder in Dollen,
siehe Mooropferfunde
mit Heeresausrüstung
(z.B.
Illerup Adal, Thorsberg, Kragehul). Vielleicht
beschleunigte der Druck aus dem Osten eine Umsiedlung von Jüten
und Angeln nach Britannien? Man kannte die Insel gut und einige
von ihnen leisteten dort Dienst als Foederaten im spätröm.
Heer um 400. Familien zogen nach und Jüten hinterliessen
Spuren als Siedler in Kent. Nach Abzug der röm Armee war die
britische Bevölkerung aus Norden und Westen
piktisch-irisch-walisischen Angriffen ausgesetzt und nötigte
sie wohl german. Kontingente anzuwerben. Vermutlich war die
Bezahlung ein Problem. Es kam zu Aufständen der Söldner.
Sie unterwarfen die Einheimischen und etablierten eigene
Herrschaftsbereiche. Im VII. Jh gab es durch die Christianisierung
von
Süden aus zahlreiche Verbindungen zum fränk. dominierten
Kontinent, was eine Angleichung
der angelsächs. Mode
bewirkte.
Zu den Schiffstypen, wie sie in Gräbern aus Sutton
Hoo oder
Snape
in
East Anglia (ca 600-625 AD) überliefert sind heißt es
allgemein, dass über Besegelung keine Aussage möglich
sei, da sich nur die Schiffsformen durch Klinkernägel
erhielten. Segel erfordern einen starken Kiel, die Bauweise oben
genannter dänischer Küstenruderer war dafür
ungeeignet. Aber Nordseeanrainer kannten Segel seit römischen
Zeiten. Angel, Sachsen und Jüten werden Segel bei ihren
Überfahrten genutzt haben (!), der Chronist Gildas
(gest.
570) erwähnt ganz eindeutig Segel an den cuyls
der Barbaren. Also
ist „Nydam“
ein
Holzweg, der seit langem in der Forschung beschritten wird - Warum
?
Es gab auch recht frühe Angriffe auf den Kontinent. Merowing. Quellen berichten von Plünderungen der friesischen Küste um 520, als das Reich Theuderichs I. von „Seekriegern“ heimgesucht wurde, mglw Dänen unter Chochilaichus. Während der Zwistigkeiten nach dem Tod des Hausmeiers Pippins II., griffen 716 Friesen an, manche Quellen nennen Sachsen, welche mit ihren Schiffen den Rhein hinauf fuhren. Angriffe auf die westeurop. Küste waren im IX. Jh damit keine neue Erscheinung. Die hochseetüchtigen Schiffe blieben durch geringen Tiefgang für das Inland gefährlich. Diese Konstruktionen besassen den starken Kiel, da gotländische Bildsteine des frühen VIII. Jhs Besegelung zeigen. Die Plankengänge waren mit Eisennieten geklinkert, überlappend angebracht. Für enge Manöver und um flußaufwärts zu gelangen blieb die Ruderfähigkeit erhalten, der Name Rus könnte vom Rudervorgang ableitet sein. Stromschnellen umging man im Osten mit Hilfe des Pferdezugs, immerhin waren teilweise über 10 to zu bewältigen, in Westeuropa bestand die Möglichkeit Treidelpfade zu nutzen, falls die Versorgung großer Invasions-Armeen landeinwärts dies erforderte. Denn nach den raids mit ihrem Überraschungsmoment hatten die Angriffe im letzten Drittel des IX. Jhs erheblich grössere Dimensionen angenommen.[6]
 Im
Westfrankenreich oblag die Abwehr den Grafen mit Befestigung der
Küstenorte, während Kg Karl
II. (d
Kahle 843-877) sein Offensivheer
mit
Panzerreitern bei inneren Thronstreitigkeiten einsetzte mit
Gebietsausweitungen nach Lotharingen sowie Italien als zeitgleich
sein ostfränk. Stiefbruder Ludwig
(d
Deutsche 843-76) durch Feldzüge gegen Slawen gebunden war.
Große Nordische Verbände schreckten nicht vor
befestigen Städten zurück, als „Holzprofis“
beherrschten sie alle Künste in Angriff und Verteidigung mit
dem Bau von Kriegsmaschinen oder Anlage von Feldbefestigungen.
Höchst motiviert waren sie lokalen Defensiv-Aufgeboten
(militia)
überlegen. Gegenüber dem schwer gerüsteten fränk.
Feldheer hingegen mussten sie auch Schlappen einstecken, so 880,
881 oder 891. Alle Vorteile lagen auf dem Wasser. 864 hatte Lothar
II. v
Lotharingen (855-869) angeregt selbst Schiffe zu rüsten, um
nordische Plünderer von den Rhein-Inseln zu vertreiben, doch
fand sein Vorschlag wenig Zustimmung. In Silber gezahlte Tribute
sorgten dafür, dass sich weitere Nordmannen den Anführern
solch lukrativer Unternehmungen anschlossen. Der
Gefolgschaftserhalt
verlangte
kostbare Objekte und Edelmetalle: „...
mit Waffen und Gewändern / sollen Freunde sich Freude machen
/ das sieht man an sich selbst / Gabe und Gegengabe begründet
Freundschaft …“
[Edda,
Havamal 41].
Im
Westfrankenreich oblag die Abwehr den Grafen mit Befestigung der
Küstenorte, während Kg Karl
II. (d
Kahle 843-877) sein Offensivheer
mit
Panzerreitern bei inneren Thronstreitigkeiten einsetzte mit
Gebietsausweitungen nach Lotharingen sowie Italien als zeitgleich
sein ostfränk. Stiefbruder Ludwig
(d
Deutsche 843-76) durch Feldzüge gegen Slawen gebunden war.
Große Nordische Verbände schreckten nicht vor
befestigen Städten zurück, als „Holzprofis“
beherrschten sie alle Künste in Angriff und Verteidigung mit
dem Bau von Kriegsmaschinen oder Anlage von Feldbefestigungen.
Höchst motiviert waren sie lokalen Defensiv-Aufgeboten
(militia)
überlegen. Gegenüber dem schwer gerüsteten fränk.
Feldheer hingegen mussten sie auch Schlappen einstecken, so 880,
881 oder 891. Alle Vorteile lagen auf dem Wasser. 864 hatte Lothar
II. v
Lotharingen (855-869) angeregt selbst Schiffe zu rüsten, um
nordische Plünderer von den Rhein-Inseln zu vertreiben, doch
fand sein Vorschlag wenig Zustimmung. In Silber gezahlte Tribute
sorgten dafür, dass sich weitere Nordmannen den Anführern
solch lukrativer Unternehmungen anschlossen. Der
Gefolgschaftserhalt
verlangte
kostbare Objekte und Edelmetalle: „...
mit Waffen und Gewändern / sollen Freunde sich Freude machen
/ das sieht man an sich selbst / Gabe und Gegengabe begründet
Freundschaft …“
[Edda,
Havamal 41].
Aufwändige Kammergräber und Grabfunde waren zunächst Anzeichen für wohlhabende freie Grundbesitzer und später Regionalbefugte des Königs in Angleichung der Verhältnisse zum Kontinent. Denn es vollzog sich im XI. Jh ein Wandel hin zur Zentralgewalt eines Königs durch Machtkonzentration auf wenige Familien mit Unterstützung der Kirche im Zuge der Christianisierung, in Dänemark früher als in Schweden, nach dem Motto: ein Gott – ein Herrscher. Als die Königtümer sich befehdeten wurden ihre Küsten von plündernden Slawen angegriffen, somit traf Nordmannen nun die gleiche Taktik, die sie selbst einst angewendet hatten. Auch Haithabu war in den dän. Thronwirren 1066 Ziel einer slaw. Attacke, was eine Umsiedlung nach Schleswig bewirkte. Nach kleineren Gegenschlägen erfolgte erst 1168 unter Kg Waldemar I. (1157-82) mit Einnahme Rügens eine erfolgreiche große Gegen-Operation, was die Richtung für die nächsten Jahrhunderte wies mit Ausbreitung des dän. Machtbereichs in Norddtld und entlang der Ostseeküste.
---
6. Rekonstruktion westl. Kreis (Norwegen, Dänemark) {in Bearbeitung}
Norwegen bietet aufgrund der Gebirge nur begrenzte Siedelflächen am Küstensaum und in den Tälern. Die Kargheit des Landes macht die Nutzung des Meeres unabdingbar mit Entwicklung der Schiffahrt seit der Bronzezeit, was Schlüsselpositionen an der Küste und gute Verbindungen über die Nordsee an die dän Küste schuf. Bereits zur RKZ bildeten sich deutliche Machtzentren in den Fjorden und auf vorgelagerten Inseln aus. Verbesserte Schiffstechnik, Erfahrung und Wagemut erweiterten die Aktionsradien. Die Shetlands und Orkneys wurden Drehscheiben, der Weg nach Westen führte an der schottischen Nordküste entlang über die Hebriden nach Irland, eine riskante Route über die Faröer ins weit entfernte Island. Auf Südkurs erreichte man die Ostküste Englands. Wie bereits skizziert scheinen Dänen im Ursprung aus dem schwed. Skane/Schonen zu stammen und waren bis zum V. Jh in mehreren Wellen nach Jütland übergesetzt. Der Südzipfel Schwedens blieb bis ins XVII. Jh dänischer Machtbereich, wie lange Zeit auch das südliche Norwegen. Die Entwicklung Dänemarks war stärker an den Kontinent gebunden und von anderen Formen geprägt als die nördlichen und östlichen Teile Skandinaviens. Früh hinterliessen feudale Strukturen ihre Spuren mit der Ausbildung des gepanzerten berittenen Streiters nach fränk.-otton. Vorbild. So barg man neben Knebellanzen und Sporen aus dänischen Gräbern zB aufwändige Pferdetrensen mit Seitenstangen und -backen, oft verziert, Zeichen von hochrangigen Nutzern, während aus dem Rest Skandinaviens oder slaw. Raum eher schlichte asymmetrische „Wassertrensen“ bekannt waren.
--
Dänen / Danelag
Rechts Karol.-sächs. Schnallentyp mit Belegen im dän. Bereich, ganz rechts Schnalle Typ Haithabu BrGr347, Zunge dänisch (Aggersborg), div. Funde auch im Danelag (z.B. York, Cottam, Stamford Bridge)
[Beginn der dauerhaften Besiedelung Ostenglands durch Skandinavier seit den 870er Jahren. Die Bezeichnung „Danelag“ stammt aus späterer Zeit]
--
IX-X_005q_bz oder vs [Abb.]
20 mm Riemen (natur/braun/rot)
und Tierkopf-Zunge („free ring“) nach Thomas B5.1_vs
montiert 99,00 EUR bz / 120,00 EUR vs
-
IX-X_012q_bz oder me
20 mm Riemen (natur/braun/rot)
und Tierkopf-Zunge nach Thomas B5.1_bz oder me
montiert 99,00 EUR--
-
Dänen / Danelag
Karolingischer Schnallentyp mit stilisierten Akanthusblüten, Funde im dän. Duesminde, Sonderjyllas oder Nora Vedby auf Alsen, im schwed. Birka und Ostra Paboda, in Haithabu Variante mit degeneriertem Muster (FrGr497 in si), ebenso aus Schiffsgrab in der Bretagne. Als Statussymbole im Norden begehrt, wie Zungen, Fibeln, Zaumzeug oder Klingen, deshalb bis ins X. Jh genutzt. Ganz rechts Schnallentyp mit Flechtbandzier, Zunge dänisch.
[Ausf. in Sterling-Silber mgl]
-
IX-X_001q_bz oder me [Abb me]
15 mm Riemen (natur/braun/rot)
und Tierkopf-Zunge nach Thomas B5.1_bz oder me
montiert 129,00 EUR
[in Haithabu Lederreste unter Beschlag der Schnalle]
-
20 mm Riemen (natur/braun/rot)
und Tierkopf-Zunge nach Thomas B5.1_bz oder me
montiert 99,00 EUR
-
Dänen / Danelag
Zunge „Typ York“ mit „Zopfmuster“ im Jellinge-Stil des X. Jhs, original Bein (auch umsetzbar), wahlweise Variante Nietscheiben ganz rechts oder mit „Nietblech“ siehe oben ähnlich IX-X_005c
-
X-XI_022k_bz (kurzes Blech)
20 mm Riemen (natur/braun/rot)
und Zunge Typ York_bz
montiert 99,00 EUR
-
X-XI_022k_bz (langes Blech)
20 mm Riemen (natur/braun/rot)
und Zunge Typ York_bz
montiert 99,00 EUR
-
Norweger / Dänen / Danelag
Rechts schmale Zunge Gokstad um 900
Ganz rechts früher Schnallentyp, auf dem Kontinent bereits zur MWZ nachweisbar, Im Norden Funde bis ins X. Jh, Zunge „Typ York“ im Jellinge-Stil, wahlweise Variante Nietscheiben oder mit „Nietblech“ siehe oben ähnlich IX-X_005c
-
X-XI_022k_bz
Schnallentyp mit kurzem Blech
20 mm Riemen (natur/braun/rot)
und Zunge Geflecht schmal_bz
montiert 99,00 EUR
-
IX-X_007k_bz
20 mm Riemen (natur/braun/rot)
und Zunge Typ York_bz
montiert 110,00 EUR
siehe Gürtel mit Eisenschnallen VIII.-XI. Jh
Zu den Kategorien A-E im Detail: Gesellschaftsstrukturen des FMAs
VIII
-
X
7. Rekonstruktionen Birka {in Bearbeitung}
Seit römischen Zeiten gab es intensive Kontakte vom Kontinent nach Norwegen und Schweden, die in der Völkerwanderungszeit nicht abrissen. Ein großflächiges Befestigungswesen in Schweden wird als Zeichen kriegerischer Ereignisse gewertet, zugleich sind damit hierarchische Strukturen verbunden. Die heutigen 25 Provinzen gehen auf Herrschergeschlechter im I. JtsdAD zurück, wie zur Vendelzeit (VI.-VIII. Jh.) mit weitreichenden Verbindungen. Zugleich war vor allem im landwirtschaftlich geprägten Süden die Anzahl freier Herren hoch, alleine in Skane/Schonen werden heute noch rd 1000 Herrenhäuser (-hus) gezählt. Die Grundherren waren Eigentümer, keine Lehnsnehmer, mit persönlichem Gefolge, Hörigen, Gesinde, so dass sich in Schweden erst spät eine Feudalherrschaft mit Land vergebendem König ausprägte.
Funde aus Birka (verm. von bjór „Biber“), auf einer Insel im Mälarsee westl. von Stockholm, sind nach Gründung im VIII. Jh in eine Frühphase (karoling. Einfluß, siehe Gürtel der Karolingerzeit) und eine späte ab Ende IX. Jh zu unterteilen. Das Areal der im Schnitt rd 500 Einwohner zählenden Siedlung lag, ähnlich wie Haithabu, geschützt im Landesinneren mit Anbindung zum Meer, von einem Halbkreiswall umgeben, die „Schwarze Erde“. Daran schloß sich erhöht die Burg an, auf einer Terrasse darunter die Garnison. In den östl. und südl. Gräberfeldern wurden bislang 1255 Gräber untersucht mit Konzentrierung auf die Hälfte der Bestattungen in „Hemlanden“ östlich des Walls und einem Viertel im Umfeld von Burg/Garnison. Ältere Gräberfelder streuen über die Insel (bis zu 3000 Bestattungen vermutet), jüngere wohl erst im XI. Jh von Dorfbewohnern nach Untergang der Stadt genutzt, weisen nur wenig Beigaben auf. Registriert bis dato: 113 herausgehobene Kammergräber [die Hälfte davon mit Waffen], 202 Kisten-, 210 Skelett- und 629 Brandgräber, plus 71 Sonstige. Das Fundspektrum belegt durch Importe weitreichende Handelskontakte, besonders aus den gut ausgestatteten Kammergräbern vor Mitte des X. Jhs. Bislang wurden nur aus 29 Männer- und 3 Frauengräbern Gürtelteile geborgen, die Hälfte davon Brandgräber, damit weisen bislang weniger als 2,5% der Gräber Schnallen und/oder Zungen auf. Ab 875c finden sich in der zweiten Birka-Phase vermehrt Artefakte der Reitervölker aus Gräbern im Bereich der Garnison mit „orientalischen Objekten“, deshalb unter Nomadische Gürtel aufgeführt. Zu den typischen Grabbeigaben gehören Gürtel in Birka, wie überhaupt im Nordischen (Ausnahme Gotland), nicht. Aufgrund der Altgrabung vom Ende des XIX. Jhs ist eine Geschlechts-Zuordnung nur nach den Aufzeichnungen Stolpes durch Vergesellschaftung spezifischer Werkzeuge, Schmuckformen oder Waffen möglich. Damit sind manche Erkenntnisse von den berühmten Fundorten ausschnitthaft. Denn es wurden selten vollständige Flächen untersucht, Gräber waren oft schwer erkennbare Brandbestattungen oder ehemals reiche Ausstattungen beraubt worden, verwertbare Ergebnisse stammen vielfach aus Altgrabungen, das erschwert in mancher Hinsicht präzise Aussagen, wenn sich Erfassung, Dokumentation, Lagerung oder Zuordnung der Funde in einzelnen Fällen als unsicher erweist.
In der zweiten Hälfte des X. Jhs erfolgte der allmähliche Niedergang des „vicus Birca“ [Bez. nach Rimberts „Vita Anskarii“]. Osthandel und Silbernachschub über arab. Dirhems waren lange Zeit Motor der Entwicklung. Nachdem sich aufgrund politischer Entwicklungen bei den Rhos/Rus die Handelswege änderten und arab. Währung an Silbergehalt verlor, verlagerten sich die Handelsströme in Richtung der Ostseeküste z.B. nach Wolin. Dort wirtschafteten Slawen mit Silber aus dem Harz als weithin akzeptierte Währung. Nach der Erschwerung der Zufahrt in den Mälarsee, es bildeten sich durch Absinken des Wasserspiegels wohl Stromschnellen, wurde die Umladestelle von See- auf Flußschiff zur Keimzelle des späteren Stockholm, das aber erst im XIV. Jh im Hansehandel und im Export von Eisen und Kupfer grössere Bedeutung erlangte. Für gotländische Häfen begann der Aufstieg als neue wirtschaftliche Zentren, was reichhaltige Funde auf der östlich dem Festland vorgelagerten Insel dokumentieren.
-
Birka
Karolingischer Typ im Bj KaGr750, das Original war aus Silber, damit ähnlich aufwändig wie Schwert, Zaumzeug oder die Doppelbestattung im Kammergrab, Gattin ovale Schalenfibeln bzvg.
Originalzunge war ein rechteckiger Beschlag. Das Akanthus-Muster in Skandinavien bis ins X. Jh nachweisbar, siehe dän. Duesminde, in Birka durch Münz-Datierung 1. Hälfte X. Jh bis zu einem Schiffsgrab-Fund in der Bretagne aus der 2. Hälfte.
-
IX-X_001a_bz oder me
Schnallentyp nach KaGr 750 [Abb bz]
15 mm Riemen (natur/braun/rot)
und mögliche Zunge 6 x 2 cm_bz od me
- {ersetzen durch neue Zunge „Birka“} -
-
mögliche Tragweise IX-X_001a
[Veredelung in Silber für „A“ mgl]
-
Birka
![]() Bj
BrGr369 im Original mit zahlreichen Beschlägen in einem Mix
aus Borre- u Jellinge-Stil, teilweise vergoldet, Variante im
reinen Borrestil auf Anfage möglich.
Bj
BrGr369 im Original mit zahlreichen Beschlägen in einem Mix
aus Borre- u Jellinge-Stil, teilweise vergoldet, Variante im
reinen Borrestil auf Anfage möglich.
[Vergütung für „A“ in Silber oder Gold mgl]
-
X_XI_024o_bz
Schnallentyp nach BrGr 369
15 mm Riemen (natur/braun/rot)
und Tierkopfzunge Geflecht_bz
- Kombi momentan nur in me lieferbar -
-
IX-X_012da_bz oder me
20 mm Riemen (natur/braun/rot)
und Zunge „Typ Birka“_bz oder me
montiert 99,00 EUR
-
Birka

Rechts Bj KaGr1076 Schnalle mit Borre-Geflecht, das Original mit breitem Ortblech als Zunge
Ganz rechts Bj Gr1030, hier in Kombination mit Zunge Flechtzier wie aus Bj Gräbern 369, 917, 918 oder 949ae
[längeres Ort- oder Schnallenblech mgl siehe z.B. oben X-XI_022k_bz]
-
X-XI_021m_bz
Schnallentyp nach KaGr 1076
30 mm Riemen (natur/braun/rot)
und Zunge Geflecht breit_bz
montiert 129,00 EUR
-
X-XI_022m_bz
Verkleinerte Variante nach Gr 1030
20 mm Riemen (natur/braun/rot)
und Zunge Geflecht_bz
montiert 99,00 EUR
-
Birka

Bj KaGr949
[Saxaufhängung aus KaGr949 mgl]
Rechts Zunge Geflecht wie in Bj Gräbern 369, 917, 918 oder 949ae
[Probebilder, Schnallenblech noch nicht poliert]
-
X-XI_025m_bz oder me
Schnallentyp nach KaGr 949
20 mm Riemen (natur/braun/rot)
und Zunge Geflecht_bz
montiert 125,00 EUR
-
X-XI_025ra_me
Schnallentyp nach KaGr 949
20 mm Riemen (natur/braun/rot)
und Zunge Kettengeflecht_me
montiert 125,00 EUR
-
Birka

Rechts Bj BrGr229, das Original ohne erhaltene Zunge oder Ortblech, hier ergänzte Variante [Detailbild schmales Ortblech]
Ganz rechts nach Bj KaGr949, s.o., hier mit langem Ortblech
[Probebilder, Schnallenblech noch nicht poliert]
-
X-XI_026a_bz
Schnallentyp nach BrGr 229
25 mm Riemen (natur/braun/rot)
und breites Ortblech_bz [Detailbild schmal]
montiert 110,00 EUR
-
X-XI_025a_bz oder me
Schnallentyp nach KaGr 949
20 mm Riemen (natur/braun/rot)
und langes Ortblech schmal_bz
montiert 125,00 EUR
...der Anfang ist gemacht...
…weiteres folgt, neue Ausführungen am Marktstand...
siehe Gürtel mit Eisenschnallen VIII.-XI. Jh
Zu den Kategorien A-E im Detail: Gesellschaftsstrukturen des FMAs
IX
-
XI
8. Rekonstruktionen Gotland, Ost-Slawen, Rus und Reiternomaden {in Bearbeitung}
 Auf
Gotland
ist
die Anzahl der Gürtelteile in den rd 1100 untersuchten
Gräbern hoch. Die Insel vor der schwed. Ostküste nahm
eine Sonderstellung ein. Neben Grab- wurden hinzu rund 700
Depotfunde gemacht, ein Indiz, dass sich dort hoher Reichtum
angehäuft hatte. Das läßt Bedrohungsszenarien
vermuten - „aus Spaß vergräbt man nix“. Das
Fundspektrum zeigt einen starken Ost-Einfluß. Den Ringfibeln
und Waffen nach zu urteilen stammen die meisten Gürtelensembles
aus Männergräbern. Bei den Frauen erstaunt die Anzahl
aufwändiger Tierkopf-Fibelkombinationen. Entlang
der osteurop. Flüße hatten Schweden befestigte
Stationen (gardariki)
angelegt, aus denen sich regionale Machtzentren entwickelten, wie
z.B. Smolensk,
in dessen Nähe Gräberfelder mit 5000 Bestattungen
gefunden wurden, in der Masse mit slawischem Hintergrund, einige
aber eindeutig nordisch. Kiew,
Hauptstadt der südlichen Rus, war mglw bereits zur Zeit des
Ostgotenkönigs Ermanerich im IV. Jh von Bedeutung, als
Danparstadir
(Dnjeprstadt)
und skand. später Kaenugardr.
Folgenschwer
war die Begegnung mit Byzanz,
Slawen
nannten es Zargrad.
und Ukraine
meinte
“Grenzland“.
Die Oströmer sahen sich erneut, wie seit den Zeiten der
Goten, im Schwarzen Meer mit einer Macht konfrontiert, die Schiffe
für Handel und milit. Aktionen geschickt einsetzte. In der
Annäherung an das byz. Kaiserhaus wurde Wladimir v Kiew
987
orthodox getauft. Durch die „heilige Salbung“
versprach er sich die göttliche Legitimation als Großfürst
über die anderen Fürstentümer zu herrschen. Noch in
der russ. Geschichtsschreibung der Rurikiden bemühte man sich
eine Legitimation des Zarentums vom röm Kaiser Augustus
abzuleiten. Die Hinwendung nach Byzanz sollte sich auch in der
Mode zeigen. Perlen- bzw edelsteinbesetzte Kleidung und breite
Schärpengürtel, wie sie im Westen bis zur Wende
XII./XIII. Jh zu beobachten waren, zeigten sich noch viel später
auf Fresken des XV./XVI. Jhs im Festsaal des Moskauer
Facettenpalastes. Schmale Gürtelformen waren Anleihen bei
Reitervölkern (s.u.), zugleich
Handelspartner und Bedrohung.
Auf
Gotland
ist
die Anzahl der Gürtelteile in den rd 1100 untersuchten
Gräbern hoch. Die Insel vor der schwed. Ostküste nahm
eine Sonderstellung ein. Neben Grab- wurden hinzu rund 700
Depotfunde gemacht, ein Indiz, dass sich dort hoher Reichtum
angehäuft hatte. Das läßt Bedrohungsszenarien
vermuten - „aus Spaß vergräbt man nix“. Das
Fundspektrum zeigt einen starken Ost-Einfluß. Den Ringfibeln
und Waffen nach zu urteilen stammen die meisten Gürtelensembles
aus Männergräbern. Bei den Frauen erstaunt die Anzahl
aufwändiger Tierkopf-Fibelkombinationen. Entlang
der osteurop. Flüße hatten Schweden befestigte
Stationen (gardariki)
angelegt, aus denen sich regionale Machtzentren entwickelten, wie
z.B. Smolensk,
in dessen Nähe Gräberfelder mit 5000 Bestattungen
gefunden wurden, in der Masse mit slawischem Hintergrund, einige
aber eindeutig nordisch. Kiew,
Hauptstadt der südlichen Rus, war mglw bereits zur Zeit des
Ostgotenkönigs Ermanerich im IV. Jh von Bedeutung, als
Danparstadir
(Dnjeprstadt)
und skand. später Kaenugardr.
Folgenschwer
war die Begegnung mit Byzanz,
Slawen
nannten es Zargrad.
und Ukraine
meinte
“Grenzland“.
Die Oströmer sahen sich erneut, wie seit den Zeiten der
Goten, im Schwarzen Meer mit einer Macht konfrontiert, die Schiffe
für Handel und milit. Aktionen geschickt einsetzte. In der
Annäherung an das byz. Kaiserhaus wurde Wladimir v Kiew
987
orthodox getauft. Durch die „heilige Salbung“
versprach er sich die göttliche Legitimation als Großfürst
über die anderen Fürstentümer zu herrschen. Noch in
der russ. Geschichtsschreibung der Rurikiden bemühte man sich
eine Legitimation des Zarentums vom röm Kaiser Augustus
abzuleiten. Die Hinwendung nach Byzanz sollte sich auch in der
Mode zeigen. Perlen- bzw edelsteinbesetzte Kleidung und breite
Schärpengürtel, wie sie im Westen bis zur Wende
XII./XIII. Jh zu beobachten waren, zeigten sich noch viel später
auf Fresken des XV./XVI. Jhs im Festsaal des Moskauer
Facettenpalastes. Schmale Gürtelformen waren Anleihen bei
Reitervölkern (s.u.), zugleich
Handelspartner und Bedrohung.
-
Gotland / Rus

Visby Ksp. Kopparsvik/Gotland,
Gräberfeld o. Grabnr.
ähnlich auch Ksp. Hellvi/Gotland Gr226
[mehrere Zungen auf Anfrage möglich]
-
X-XI_027a_bz mit Zier
25 mm Riemen (natur/braun/rot)
und schmales Ortblech_bz [Detailbild breit]
montiert 149,00 EUR
-
mögliche Tragweise Kopparsvik Gr11
[Modell nicht mehr lieferbar]
-
Gotland / Rus / Ost-Slawen

Ganz rechts Typ Ksp. Hellvi/Gotland
-
Schnallen mit „abgesetztem Steg“ haben eine sehr lange Geschichte. Frühe Formen sind aus Ostasien um Christi Geburt (nach westl Zeitrechnung) bekannt, Transfer über Reitervölker, Übernahme in Byzanz und Verbreitung in Ost- und Mitteleuropa
[Verteiler, wie auf dem Grabungsfoto oben mgl]
-
IX-X_Ksp_Väte_bz
20 mm Riemen (natur/braun/rot)
Typ Ksp. Väte/Gotland
mit Zungenblech_bz 7 x 2 cm
montiert 99,00 EUR
-
IX-X_04_bz oder vs [Abb]
20 mm Riemen (natur/braun/rot)
Typ Ksp. Hellvi/Gotland
mit Zunge_bz oder vs 4 x 2 cm
montiert 99,00 EUR bz oder vs
-
Reitervölker / Rus / Birka
Teile „Orientalisch-bulgarischer Gürtelformen“ in Haithabu als Handelsgut nachweisbar und in Birka nach 900 als Grabfund im Bereich der Garnison, oft Bestandteil vielteiliger Garnituren. Abgebildete Variante als Derivat einer solchen Garnitur, Zierbeschläge und Nebenriemen auf Anfrage mgl.
mögl. Tragweise als Alternative zur „Reenacter-Schlaufung“, für die es m.E. in dieser Zeit im Gürtelbereich keine eindeutigen Belege gibt. Nur in Sonderfällen, wie beim Pferdegeschirr, werden Schlaufungen genutzt, da Riemen auf unterschiedlich große Tiere eingestellt werden mussten
-
X-XI_009_bz
20 mm Riemen (natur/braun/rot)
„Oriental. Typus“ mit Zunge_bz
montiert 99,00 EUR
-
IX-X_031f_bz
20 mm Riemen (natur/braun/rot)
und mögliche Zunge im spätawar.Stil_bz
montiert 99,00 EUR.
-
Reitervölker / Rus / Ost-Slawen
Riemenende rechts als Derivat eines spätawar. Scharnierbeschlags zur Zunge verwendet, wie es in Zweitverwendung gemacht wurde.
Schnalle ganz rechts mit stilisierten Akanthusblüten kombiniert mit Zunge im „Tamga-Stil“ der Petschnegen oder Bulgaren als mögl. Handels- oder Beuteobjekt in Ost und Nord, wie es zur Entlohnung des Gefolges üblich war.
-
X-XI_003f_bz
20 mm Riemen (natur/braun/rot)
und mögliche Zunge im spätawar.Stil_bz
montiert 99,00 EUR
-
IX-X_003h_bz
20 mm Riemen (natur/braun/rot)
und mögliche Zunge_bz
montiert 110,00 EUR
-
Reitervölker / Rus
Schnallentyp bereits seit der MWZ nachweisbar, Zungen im „Tamga-Stil“ der Reitervölker als mögl. Handels- oder Beuteobjekt in Ost und Nord, wie es zur Entlohnung des Gefolges üblich war.
[auf den Bildern Schnallenbeschlag noch nicht vernietet, nur lose auf das Leder gesteckt]
-
IX-X_007g_bz
20 mm Riemen (natur/braun/rot)
und mögliche Zunge_bz
montiert 99,00 EUR
-
IX-X_007h_bz
20 mm Riemen (natur/braun/rot)
und mögliche Zunge_bz
montiert 99,00 EUR
-
Magyaren / Slawen / Rus
Schnalle rechts mit stilisierten Akanthusblüten. Funde aus dem mährischen Reich, 2. Hälfte IX. Jh.-
Die magyarische Zunge verweist auf sivg Taschenbeschläge und Mützenspitzen aus der Landnahmezeit um 900. Die Anregung stammte von Seidenstoffen aus dem sogdischen Raum. Nutzer der Taschen waren Gefolgsherren, welche die Ursprungsmotive wohl noch aus eigener Anschauung vor Ort kennen gelernt hatten [EM1000_III, S. 310f].
Zier-Beschläge auf Anfrage mgl, sie waren wie die Durchzüge zum Anlaschen von Gerät gegossen, Blech-Formen verwendete man eher für die Kleidung. Die bz Zunge kann durch Oberflächenveredelung in si höheren Darstellungen gerecht werden.
-
IX-X_004i_bz
30 mm Riemen (natur/braun/rot)
und mögliche Zunge_bz
montiert 129,00 EUR
-
X-XI_003i_bz
25 mm Riemen (natur/braun/rot)
und mögliche Zunge im magyarischen Stil_bz
montiert 110,00 EUR
„Reitervölker“ meint Pferdezüchter und vornehmlich Awaren, Magyaren und Bulgaren sowie Chazaren, Usbeken, Petschenegen, Kumanen oder Seldschuken. Die „Herren der Wüste“, welche auch Esel oder Kamele nutzten, zählen streng genommen nicht zu den Reitervölkern, wie Beduinen (badawi = Wüstenbewohner), Berber, Mauren und Sarazenen. Vielfach herrschten mit Bindesystemen und „Koppelschlössern“ Gürtelformen vor, die nach Indien und Fernost verwiesen. Manche oben aufgeführte Rekonstruktionen sind als vereinfachte vielteilige Garnituren mit Nebenriemen aufzufassen. Sie können ergänzt werden, wie auf der vorangegangenen Seite die Kombination VII_090_bz, späte Varianten hatten Scharnierkonstruktionen. Magyaren verwendeten statt der Nebenriemen Durchzüge, deshalb gab es keine Nebenriemenzungen, in der skand. Forschung oft als „orientalische oder bulgarische Gürtel“ bezeichnet. Bei den Magyaren weisen Material und Anzahl der gegossenen Beschläge, bis zu 50 Stück meist sivg, auf den hohen Rang des Trägers hin [Beschläge auf Anfrage]. Bislang sind von 143 magyar. Fundorten 184 Gräber mit solchen Gürteln bekannt, die sich nicht gleichen (!), geschmückt mit Sippen-, Familien- oder individuellen Besitzzeichen [EM1000_III_316]. Gürtel spielten bei nomad. Völkern eine wichtige Rolle, zum Anlaschen der Ausrüstung und nicht zuletzt um Kleidungsstücke der Männer, meist Klappenröcke, zu schliessen. Eine Kategorisierung von A-E erweist sich für Reiternomaden als schwierig, da sie ein eigenes Gesellschaftssystem prägt.
siehe auch Rubrik Gürtel mit Eisenschnallen VIII.-XI. Jh [D-E]
Nomaden (von griech. „nomas“ = weiden) sind sesshaften Kulturen vielfach unverstanden und letztere blicken gewöhnlich auf sie herab. Der lat. Begriff für Ackerbau „cultivare“ („Kultur“) schließt nomadische Völker als Kulturschöpfer aus. Ungeachtet dessen lagen die Ursprünge der westlichen Hochreligionen im Nomadismus begründet! Der Vordere Orient bot über Jahrtausende viehzüchtenden Wandervölkern Lebensraum. Überheblichkeiten scheinen unangebracht, denn vielfach gewannen Nomaden die Oberhand. Frühe Beispiele mögen semitische Volksstämme aus dem heutigen Syrien oder halbnomadische Bergvölker des Zagros-Gebirges sein, die zur Bronzezeit nach Mesopotamien einfielen und die Kontrolle im Zweistromland übernahmen, ein frühes Hochzentrum urbaner Zivilisation! Sie zerstörten die Städte nicht, sondern forderten Tribute und glichen ihre Kultur der sesshaften an, ließen sich nieder. In den nächsten zwei Jahrtausenden folgten erneute Einwanderungen aus Regionen nördlich des Kaukasus und östlich des Kaspischen Meeres mit Pferd und Wagen (Hyksos, Hurriter, etc) sowie Reflexbögen und technologisch und metallurgisch überlegenen Waffen aus Eisen statt Bronze (Kimmerer, Skythen, etc). Die eurasische Steppe gilt als eine der größten nomadischen Lebensräume mit teilweise unwegsamen Wüsten- und Gebirgsregionen. Fernöstliche Steppengebiete, recht hoch gelegen, sind klimatisch rau durch schneereiche Winter mit tiefen Temperaturen. Südliche und westliche Regionen bieten ein annehmbares Klima, wenn auch mit heißen Sommern und Trockenperioden. Jahreszeitlich bedingte Wanderzüge dienten dazu den Zuchtviehbestand durch Wechsel der Weiden zu erhalten. Notsituationen veranlassten Steppenvölker des Ostens aber immer wieder zu grossen Wanderungen in Richtung auf die chines. Flusslandschaften, in den Raum südlich des Urals (Usbekistan, Tadschikistan, etc) oder man suchte Weidegründe in den „südrussischen“ Ebenen, selbst der Kaukasus wurde, wie bereits erwähnt, überschritten. Der Besitz von Pferden oder Kamelen ermöglichte große Distanzen zu überwinden. Häufig waren Nomaden Mittler im Etappenhandel, so dass sie kostbare Materialien, dessen Transport Gewinn versprach, aus weit entfernten Gebieten zusammen führen und weitergeben konnten. Zwischen Dnjepr und Donez fand man archäologisch Nomadenlager in unmittelbarer Nähe zu Siedlungen der Sesshaften. Hohe Anspruchslosigkeit und ständige Kampfbereitschaft kennzeichnen Nomaden. Das raue Dasein brachte einen abgehärteten Menschenschlag hervor, der sein Vieh, den Treck oder auch die Karawane sorgsam schützte. Auch Frauen wirkten bei Kämpfen mit, wie es seit der Antike diverse Quellen bezeugen. Ansonsten lag ihr Hauptaufgabengebiet rund um die heimische Jurte. Hundezähne als Amulette tauchen in magyarischen Gräbern nur bei Frauen auf. Der Hund als Wächtersymbol in einer Gesellschaft, welche dem Tier, verbunden mit dem Schamanismus, einen hohen Stellenwert einräumte, siehe auch Darstellung des Hundes auf Pferdegeschirrbeschlag in einem ungarischen Frauengrab [EM1000 III, S. 70].
Nomaden mit guten Orientierungssinn sind extrem anpassungsfähig, was z.B. bei abrupten Wetterwechseln, ausgelöst durch starke Winde in der Steppe, zwingend notwendig ist. Dem Viehbestand im Familien- oder Sippenbesitz wird große Achtung beigemessen, daraus resultiert ein Wertesystem für Führungspositionen. Persönliches Eigentum zählt ansonsten nicht viel. Das konnte zu starken Divergenzen führen, wenn nomadische und sesshafte Kultur aufeinander trafen, denn letztere misst individuellem Besitz hohe Bedeutung bei. Als eine Art „sportliche Betätigung“ junger Nomaden war es möglich, dass man bei unliebsamen „Nachbarn“ oder sesshaften Völkern auf Beutezug (arab. ghazw, ghazwa = Razzia) ging. Interessant waren vornehmlich Dinge, welche das Leben des Sippenverbandes in unwirtlicher Gegend ermöglichte. In einer lebensfeindlichen Umwelt, die kaum Fehler verzeiht, garantiert nur der Zusammenhalt das Überleben. Auf Weideland besteht lang tradiertes Nutzungsrecht, wird aber durchaus tolerant mit anderen geteilt. Wenn sesshafte Kultur und Nomadentum aufeinander prallen gibt es oft spannungsgeladene Angleichungsprozesse. Nomaden waren Mittler von Gütern und Ideen aus weit entfernten Gegenden, die Sesshaften boten Agrarprodukte, Rohstoffe, wie Erze und Metalle und deren handwerkliche Verarbeitung. Der Austausch konnte friedlich über Märkte vonstatten gehen oder durch Beutezüge, so dass früher von einem „Raubnomadentum“ gesprochen wurde, wie man es Hunnen, Awaren, Magyaren oder Mongolen vorwarf. Heute sieht man darin eher kurzzeitige Erscheinungsformen, da nomadische Gesellschaften nicht auf Dauer von Beute allein leben konnten. Erpressung von Tributen machte abhängig, indem sich hierarchische Strukturen unter Führungspersönlichkeiten heraus bildeten mit Klientel- und Vasallenverhältnissen als markante Säulen der Herrschaft, denn Ländereien gab es ja nicht zu verwalten, wenn unterjochte Sesshafte zu kontrollieren waren. Materiell gerieten sie in Abhängigkeit der sesshaften Kultur, um Machtverhältnisse, gestützt auf Gefolgschaften, aufrecht zu erhalten. Nomadische Gesellschaften, die von ihrer herkömmlichen Daseinsform abgeschnitten waren, unterlagen einem Integrationszwang in sesshafte Zivilisationen. Umgekehrt konnten sesshafte Völker im Extremfall zur Migration und damit zu einem Nomadentum gezwungen werden, wenn die Lebensverhältnisse unhaltbar wurden, wie in den Völkerwanderungen vom IV. bis zum VI. Jh, die Europa so nachhaltig prägten.
Emaille-Fibelreplikate IX.-XI. Jh
Bis zum Ende der röm Kaiserzeit (RKZ) erforderte die Peblostracht germanischer Frauen gehobener Schichten die Fibeltragweise als Paar. In Skandinavien und im Baltikum hielt sich dies hin zur „Mehrfibeltracht“ länger als auf dem Kontinent, wo sich durch oström. Einfluß der Übergang zur einzeln getragenen Scheibenfibel mit Tunica und Umhang in der Wende um 600 vollzog. Kostbare Exemplare waren bis zu 5 cm groß aus Edelmetall, etwas häufiger in Pressblechtechnik, es gab auch schlichtere Formen aus Bronze oder Zinn-Blei-Legierungen. Hochrangige Frauen und Männer wurden mit Scheibenfibeln abgebildet [siehe Franks Casket um 700 oder Stuttgarter Psalter von c825]. Die südskand. Mode nahm sie auf, Ringfibeln mit seitlich aufgerollten Enden wechselten dort von der Frauen- in die männliche Modesphäre. Viel häufiger werden hingegen Knochennadeln, Ringnadeln und Bindesysteme verwendet worden sein, siehe „Schnurmantel“ [Birka III, S. 149, mit paarweisem Metallabschluss der Prunkmäntel S. 142]. Angeblich wurde die Mehrfibeltracht in Nord- und Osteuropa erst gegen Mitte des X. Jhs zugunsten der einen Fibel vollends abgelegt. Während in den Rus-Reichen wohlhabende Männer östlichen und oriental. Modesitten folgten, werden ovale Schalenfibeln als Traditionsbeflissenheit der Frauen gewertet. Der reisende Araber Ibn Fadlan nahm sie noch im X. Jh angeblich aus Eisen oder Kupferlegierung sowie Silber und Gold an den Rus-Frau (der Freien?) wahr [Birka III, S. 150]. Auch Bernstein- und Glasperlenschnüre als Halsschmuck fanden sich seit german. Zeiten sowohl in merowingerzeitlichen, als auch in nordischen und östl. Oberschicht-Frauengräbern, nicht selten mit Münzen und Anhängern kombiniert. In gehobenen Frauengräberensembles wurden auch zierliche Metallketten nach antikem Vorbild verwendet, durch Kettenverteiler zu Strängen kombiniert.
-
Karolinger / Nordmannen / Otton. Reichsgebiet
Scheibenfibel Kreuz mit Emaille mit weiter Verbreitung von der Küste, siehe Funde aus Dorestad, Haithabu, Schuby und dem skandinavischen Raum, über Niedersachsen und Westfalen, vom Handelsplatz am Rheinufer in Mainz oder sehr ähnlich aus der Umgebung des Königshofs in Rohr östl. von Meiningen nach 975, bis in den Donau- und Alpenraum.

Salierausstellung 1992, Raum 2, Vitrine 2, A 7
„..., dass dieser im 9./10. Jh. entstandene Fibeltyp durchaus noch im 11. Jh. (!) getragen worden ist.“ [Sal, S. 132] Burg Harpelstein bei Horath (1080 zerstört) sowie Fund der Entersburg bei Hontheim, auch die Variante aus Hagen wird ins X./XI. Jh datiert.
-
IX-XI_Scheibenfibel Kreuz_bz [D 2,9 cm]
wahlweise gelbes oder rotes Kreuz auf grünem Grund
je 39,00 EUR [„gelb-grün“ minimaler Bestand]
-
Byzanz / Rus / Slawen / Otton.-salisches Reichsgebiet
Nach neuem Forschungsstand streuen Pelta-Fibeln erheblich weiter als 1992 bekannt war, neben dem ostalpinen Raum siehe Straubinger Fibel, Fund vom Domberg in Bamberg, ähnliche Form auf dem Handelsplatz in Mainz, Schatzfund von Klein Roschaden bei Oldenburg aus dem X. Jh., annähernd auch Schleswig mit drei Pelten ohne Emaille. Letztendlich nimmt der „Terslev“-Stil das Pelta mit der „Brezel“-Form auf.
-

Pelta-Ornament, Salierausstellung 1992, Raum 2, Vitrine 1, B 7
...Kreuzemailfibeln der Stufe Köttlach II, die vorwiegend im Osten und Südosten des Reiches verbreitet war...Das Kreuzornament aus Kreispalmetten ist wahrscheinlich aus der byzant. Goldschmiedekunst übernommen worden.“ [Sal, S. 119]. Ein früher byzant. Vorläufer wäre ein krimgot. Beschlag.
-
X-XI_Scheibenfibel Pelta_bz [D 3,6 cm]
je 45,00 EUR
in dunkelblau/gelb oder rot/grün oder rot/gelb
© Alle Rechte vorbehalten. Die Inhalte dieser Seiten sind urheberrechtlich geschützt für Christian Dietz / DRAGAL. Jede Verwertung ausserhalb der engen Grenzen des Urheberschutzrechtes ist unzulässig. Letzte Bearbeitung 2025-01-29
Literatur mit Angabe oben verwendeter Kürzel [fett] siehe „Literatur FMA“